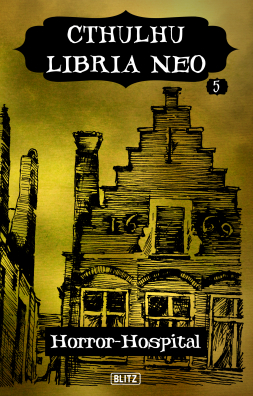Unter dem Begriff “Krankenhäuser” präsentiert Jörg Kleudgen zum fünften und letzten Mal ein besonderes Jahrbuch zur dunklen Phantastik im Blitz- Verlag. Die Inhaltsangabe auf dem Klappentext passt allerdings nicht ganz zum Inhalt dieses Taschenbuchs. So findet sich nur zwei Interviews in dieser Ausgabe. Jörg Kleudgen und Arthur Gordon Wolf sprechen ausführlich mit dem Übersetzer und Verleger Joachim Körber. Joachim geht erst auf die Kunst des Übersetzens ein, dem Gefühl der Sprache ein. Anschließend spricht er über die verlegerischen Herausfordern im Vergleich zum Autoren. Der Titel ist provokativ „Das Büchermachen ist heute völlig entzaubert“ und spricht desillusioniert, allerdings auch ein wenig einseitig aus Joachim Körbers Seele. Die Edition Phantasia ist einer der ersten Kleinverlage in Deutschland gewesen. Ein außergewöhnliches Programm, das vor allem die Sammler angesprochen hat. Inzwischen gibt es viele Kleinverlage (die Technik macht es möglich) mit entsprechenden Programmen. Es ist eher der Schritt in den Bereich des Paperbacks und der Massenvermarktung, der schwerer auf der exklusiven Seele der Edition Phantasia lastet, denn mit diesem Schritt musste sich Joachim Körber auch dem stationären Buchhandel und seiner immer schlimmer werdenden Zahlungsmoral oder den Vorstellungen der Buchhändler stellen. Das gemeinsame Gespräch und weniger klassische Interview gibt aber einen guten Einblick in das Verlagswesen, sowie die Schwierigkeiten, im Genre zu überleben.
Jörg Kleudgen stellt Graeme Phillips einen Autodidakten vor, der ein Fanzine erst herausgegeben hat, welche er ansonsten nicht die Voraussetzungen der Mitgliedschaft und damit dem Bezug anderer Fanmagazine erfüllt. Inzwischen gibt Phillips nicht nur länderspezifische Fanzines – Norwegen wäre eines der nächsten Ziel – mit Texten aus den jeweiligen Ländern heraus, sondern hat sich als Lovecraft Experte international etabliert. Auch Texte von Jörg Kleudgen haben auf diese Art und Weise den Weg ins Ausland gefunden. Grame Phillips spricht offen, immer noch enthusiastisch und ein wenig verwundert über die eigenen Anfänge. Computerprogramme haben die Grundübersetzung von Texten aus Sprachen geliefert, die Phillips niemals gelernt hat. Anschließend ging er diese groben Übersetzungen mit den entsprechenden Wörterbücher durch. So entstanden die ersten Arbeiten. Ein wunderbarer Blick aus der Gegenwart in eine Zeit, als das Erstellen von Fanzines noch harte Arbeit gewesen ist. Im Falle von Graeme Phillips liegt das nicht einmal lange in der Vergangenheit.
Der Ton der Kurzgeschichten ist sehr unterschiedlich. Christopher Müller eröffnet den Reigen mit einer von ihm selbst illustrierten Kurzgeschichte: „Doktor Nimmerlein“ leitet das örtliche Krankenhaus. Er ist morgens immer der Erste. Plötzlich sieht er eine Gestalt im Nachhemd über das Gelände wandeln und hört Musik aus einem Klavier, an dem niemand spielt. Der Autor hält das Tempo hoch, der schleichende Wahnsinn Nimmerleins wird effektiv beschrieben. Der Leser will nur den Auslöser wissen. Ein Geheimnis, das der Autor nicht verrät, aber nicht nur bei dieser Geschichte lauert das Grauen im Keller.
Deutlich humorvoller – wenigstens zu Beginn – ist Thomas „Gus“ Backus „Die wilden Geschichten des Onkels“. Der Onkel liegt mit einem gebrochenen Bein im Krankenhaus und erzählt wilde Abenteuergeschichten, wie er sich das Bein gebrochen hat. Seinem Bettnachbarn wurde nach einem Schlangenbiss im örtlichen Zoo das Bein amputiert. Als der Onkel sagt, was die Krankenschwestern und Ärzte in dieser Anstalt mit den amputierten Gliedmassen im Keller anstellen, ist die Neugierde geweckt. Der Leser weiß wie bei Christopher Müller nicht, ob die Begegnungen im Keller real oder der angestachelten, bei Doktor Nimmerlein kranken Phantasie entsprechen. Die überzogenen Erzählungen des Onkels lockern erst die Atmosphäre auf, bevor der Junge dem Grauen im Keller begegnet.
Die längste und beste Geschichte stammt von Arthur Gordon Wolf. „0,9 Sekunden“ ist die Maßeinheit für eine persönliche Ewigkeit. Die Grundidee stammte – ungewöhnlich für eine Horror Geschichte aus dem Film „Contact“ mit Jodie Foster. Im Krankenhaus lernt der Protagonist eine Frau kennen. Beide haben sich Beine gebrochen. Das Nikotin bringt sie zusammen. Sie erzählt ihm ihre tragische Geschichte, die Jagd nach einen Augenblick mit ihrer Tochter. Eben die im Titel angesprochenen 0,9 Sekunden. Sein Geheimnis behält er lange zurück. Erst am Ende der Geschichte erfährt der Leser seinen Lebensweg. Auch wenn die beiden tragischen, dreidimensionalen, so verletzlichen und dich besessenen Charaktere ein Merkmal verbindet, könnten sie nicht unterschiedlicher sein. Arthur Gordon Wolf nimmt sich den Raum, nicht nur die beiden Figuren gut zu entwickeln und sie selbst einmal gegenüber dem anderen Kranken, später auch gegenüber dem Leser etwas zu erzählen, was an Besessenheit, ab Obsession erinnert und doch in dieser sachlich nüchternden Art und Weise gänzlich überzeugend ist.
„Genius Loci: Sebaldsbrück“ von Denis Vidinski ist keine Geschichte. Es sind aneinander gereihte Impressionen, vermischt mit subjektiven Erinnerungen. Die Bilder sind stimmungsvolle Fotographien. Denis Vidinski gibt in seinem Kleinverlag eine Reihe von Heften heraus, die alle von stimmungsvollen Linoldrucken begleitet werden. Die Texte ergänzen sich gut mit den Fotos, aber die eigentliche Kunst sind die wundervollen, fast handgefertigten Drucke, die letzte Veröffentlichung war ein kleines Heft mit Gedichten von C.A. Smith
Eine Reihe von Büchern werden vorgestellt. Elmar Huber lässt in „Das Arkham- Sanatorium“ neben kurzen Zusammenfassungen der vorgestellten Texte vor allem die Autoren selbst sprechen. Auf der einen Seite kann der Leser erkennen, welche Intentionen die Autoren gehabt haben, auf der anderen Seite vermisst der Leser aber auch eine tiefer gehende Betrachtung der vorgestellten Werke. Auch die Rezension zu Joe Zybells Tom Percifal Novellen in der „Vampir“ Reihe des Zaubermonds Verlags wirkt ein wenig ungeordnet, als wenn Elmar Huber Schwierigkeiten hat, sich in die Texte einzuarbeiten.
Ebenfalls ambitioniert, aber unglücklich strukturiert ist Thomas Ulbrichs „vergessener Bücherschrank“. Die Inhaltsangabe – in diesem Fall wird der als Taschenbuch noch leicht zugängliche Roman „Medusa“ von Edward Harold Visiak vorgestellt – ist viel zu ausführlich und die anschließende Kritik zu oberflächlich, als das sich der Leser wirklich einen Eindruck von dieser Geschichte machen kann. Wer das Buch in Gänze lesen möchte, sollte nur die abschließenden Bemerkungen Thomas Ulrichs lesen.
Rainer Zuch setzt sich mit den Irrenanstalten/ Krankenhäuser in drei von Thomas Ligottis Kurzgeschichten auseinander. Der Titel „Mit Thomas Ligotti im Irrenhaus“ fasst das Werk des Amerikaner nur unzureichend zusammen, denn mehr und mehr verschwindet Rainer Zuchs Argumentation folgend die Wirklichkeit aus dem eher schmalen Kurzgeschichtenwerk des Autoren und macht dem Irrsinn, dem Abgrund, in den alle starren, aus dem sie angestarrt werden Platz. Deutlich besser ausbalanciert zwischen Information und Kritik, angereichert mit einer Reihe von entsprechenden Zitaten anderer Kritiker ist dieses Essay inhaltlich einer der Höhepunkte dieser Ausgabe.
Auch Marius von der Forst geht in seinem Essay auf Krankenhäuser bzw. Ärzte in Lovecrafts Werk ein. Der Autor schlägt den Bogen zu Lovecrafts eigener Jugend mit seinen früh verstorbenen Eltern und der eigenen Schwächlichkeit. Im Laufe des Essay hat Mark von der Forst aber ein kleines inhaltliches Problem. Krankenhäuser sind bei Lovecraft nicht zwingend Orte des Schreckens – das wäre noch akzeptabel -, aber in vielen seiner Geschichten sind es Wissenschaftler und nicht Ärzte, welche sich auf die Suche nach dem Unbekannten machen. Hier biegt der Autor die literarischen Vorlagen ein wenig zu sehr, um ausreichend Fleisch für seinen Artikel zu erhalten.
Ein wichtiger Schwerpunkt – der Titel ist ja Programm und Verpflichtung zugleich – ist die Beschäftigung mit H.P. Lovecrafts Werk. Rainer Zuch setzt sich intensiv mit den graphischen Adaptionen von Lovecrafts Werk auseinander, bei denen der Doppelband „Berge des Wahnsinns“ dank Francois Barangers cineastischen Bildern herausragt. K. R. Sanders schreibt über den „Sound der Alten“, es ist anscheinend der dritte Teil einer Serie. Der Autor geht auf die technische wie auch die inhaltliche Qualität der Musikstücke ein. Allerdings fehlt diesem Essay eine fundamentale Grundmeinung.
Jörg Kleudgen verabschiedet sich mit dieser fünften Taschenbuchausgabe seines Magazins auf einem hohen Niveau. Die Geschichten sind alle drei gut, eine sogar überdurchschnittlich. Viele der Artikel sind informativ und lesenswert. Alleine zwei bzw. drei der Buchvorstellungen weisen etwas zu Oberflächliches oder zu viel Inhalt und zu wenig Gehalt auf. Das Taschenbuch ist reichhaltig illustriert und die Zeichnungen/ Bilder harmonisieren sehr gut mit dem Inhalt dieses kleinen Jahrbuches der Phantastik, das nicht nur Lovecraft Anhänger ansprechen wird.