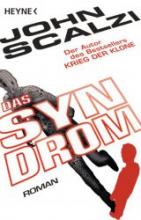
John Scalzis neuer Roman “Das Syndrom” ist im Vergleich zu den in den Tiefen des Alls spielenden Actionromanen in erster Linie eine Kriminalgeschichte mit sozialkritischen Zwischentönen, die allerdings mit den Ansätzen einer natürlich global agierenden Verschwörung, dem Verdecken von relevanten Informationen und schließlich einem Ermittler mit einer speziellen Vergangenheit auch stellenweise sehr schematisch wird. Schon in seinen ersten Science Fiction Romanen wie „Krieg der Klone“ konnte der Autor diese eher konservativen Handlungsverläufe mit einigen interessanten Variationen ergänzen, so dass die ganze Mischung relativ originell und vor allem auch spannend erschienen ist. Auch bei „Das Syndrom“ – der deutsche Titel wirkt im Vergleich zum amerikanischen Original zu mild und trifft den Kern der Erkrankung zu wenig – hat sich Scalzi teilweise erstaunlich viel Mühe gegeben, eine vertraute und doch in einem Aspekt sich stark unterscheidende amerikanische Gesellschaft zu zeichnen, wobei er vor allem im etwas zu lethargischen Mittelteil zu wenige Höhepunkte setzen kann, um abschließend überzeugend zu erscheinen.
Die große Veränderung ist eine an einen Schnupfen erinnernde Seuche, die relativ schnell die Erde überzogen hat. Zu den ersten Opfern dieser Erkrankung gehörte die amerikanische First Lady, nach der das Haden Syndrom benannt worden ist. Mehr als eine Milliarde Menschen sind an dieser ersten Welle gestorben. Zu den Symptomen der Erkrankung gehört, dass der wache und voll funktionsfähige Geist quasi in einem gelähmten Körper eingeschlossen ist. Scalzy berührt dabei ein sehr unangenehmes, aber auch aktuelles Thema. Bei den vielen dunklen Aspekten dieses Themas gelingt es aus der Sicht eines der ersten Opfer eine differenzierte Annäherung an die Folgen der Erkrankung, in dem Scalzi sentimentale Ideen umschifft, keine klassische Kur anbietet, sondern eher einen anderen Weg geht, in dessen Verlauf die technokratische Gesellschaft eine Art Brücke erschaffen hat. Um den in ihren Körpern eingeschlossenen Haden Opfern eine Rückkehr in die Gesellschaft zu ermöglichen, könnten sie ohne das Scalzi zu sehr in die Details geht, ihr Bewusstsein entweder in einen Roboter Avatar übertragen oder bei einigen wenigen Menschen sogar in deren Körper. Andere Haden Überlebende, bei denen sich anscheinend die Krankheit in einer Variation ausgestaltet hat, haben sich mit neuralen Netzen geschützt, bei denen aber die Gefahr besteht, dass sie ausbrennen. Mit wenigen drastischen Bildern lässt Scalzi diese unterschiedlichen Haden Opfer quasi Revue passieren und setzt sie mehr oder minder direkt in eine Interaktion mit ihrem Umfeld. Dabei umschifft Scalzi allerdings das Schicksal der ausschließlich in ihrem Körper eingeschlossenen Menschen, in dem er diesen echten Opfern eine virtuelle Irrealität namens Agora erschafft, in der sie von Geburt an leben können. Das bei diesen Menschen wenig Neigung besteht, der Realität in welcher Form auch immer zu begegnen, ist verständlich und wird eher in Form eines neuen, nicht behinderten Menschen in einer gänzlich verfremdeten Umgebung beschrieben. Außerhalb dieser Krankheit und ihren sozialen Aspekten beschreibt Scalzi eine nahe Zukunft, die auf wenig futuristische Technik zurückgreifend im Grunde auch die Gegenwart des Lesers sein könnte. Dieser Ansatz lässt den zugrundeliegenden Krimiplot nicht unbedingt realistischer erscheinen, aber der Leser ist vertrauter mit der Umgebung. Alleine die verschiedenen Zweige der Haden Krankheit sollten ausreichen, um mit einem dem ersten, aber sehr bekannten Opfer als Ermittler eine solide Basis zu präsentieren.
Der eigentliche Kriminalfall beginnt natürlich in Washingtons Watergate Hotel. Wenn ein Autor die amerikanische Hauptstadt nimmt, dann muss ein Mord an diesem Ort stattfinden. In einer Hommage an einige Buddy Filme ohne die Idee im Verlaufe der Handlung wirklich offensiv zu nutzen übernimmt der gerade eine Woche im Dienst befindliche Neuling Chris Shane die Ermittlungen. Er ist ebenfalls an der Haden Seuche erkrankt und verfügt inzwischen über einen Robot Avatar Körper. Durch ein Foto mit dem Papst in seiner Jugend ist er zu einem der markanten Gesichter der Krankheit geworden. Immer wieder wird er darauf angesprochen. Um der Öffentlichkeit zu entfliehen, hat er eine Karriere als FBI Agent eingeschlagen, obwohl sein Vater nicht zuletzt aufgrund seiner Firmenbeteiligungen überdurchschnittlich reich gewesen ist, Zu der tragischen Note gehört es, dass er aus Übermut sich an der Krankheit angesteckt und indirekt zumindest seinen Vater durch Infektion getötet hat. Nicht nur dieses persönliche Schicksal verbindet ihn mit seinem neuen Partner. Natürlich hat es sich um einen amtsmüden Beamten Leslie Vann, der hinter seinem Mantel der überlegenen Arroganz eine tiefgreifende empfindliche, von inneren Selbstzweifeln sich fast zerfleischende Persönlichkeit ist. Im Vergleich zu einigen anderen Scalzi Romanen, in denen die Charakterisierung zum Teil zu breit, zu sehr entweder an eine Parodie oder auf der anderen Seite an ein literarisches Konstrukt, aber selten an vollblutige Menschen erinnern. In dieser Hinsicht gehört „Das Syndrom“ ohne Frage zu seinen besten Arbeiten.
Ansonsten folgt Scalzi den weiten Spuren des politisch paranoiden utopischen Thrillers, den Michel Crichton insbesondere zu Beginn seiner Karriere geschrieben hat. Es beginnt mit einem einfachen Mord, dessen Verwicklungen immer größer werden. Die Ermittlungen werden natürlich behindert, die ersten Erfolge relativiert und am Ende schließt sich ein Kreis. Scalzi ist kein echter Thrillerautor, so dass ihm der zugrundeliegende Kriminalplot insbesondere im Vergleich zu David Brins umfangreicheren, aber vom Ansatz her nicht unähnlichen Roman „Kiln People“ – hier erzeugen Menschen Duplikate von sich selbst – nicht gänzlich gelungen ist. Der potentielle Kreis insbesondere der Hintermänner ist zu klein und die Motive sind für erfahrene Krimifans zu schnell zu erkennen, so dass der eigentliche Täter in James Bond Manier umständlich wie unglaubwürdig natürlich im Augenblick des vermeintlichen Triumphs seine Motive, seine Vorgehensweise und vor allem seine zukünftige Intention breit und gepflegt darlegt. Natürlich darf der Roman nicht mit dem Sieg des Bösen enden, so dass der Bogenschlag konsequent, aber vorhersehbar erfolgt. Es ist schade, das Scalzi wie in seinem prämierten „ Redshirts“ Buch die grundlegende Handlung abschließend aus den Augen verliert und einen Kompromiss eingehen muss. Positiv dagegen ist, dass der Ermittler Shane – der Name ist sicher kein Zufall – im Grunde die perfekte Tarnung bei seiner Untersuchung hat, denn manchmal muss er sogar sich einen Avatar Körper leihen, da die örtlichen Behörden ihre künstlichen Leihkörper wie ihre Ausrüstung vernachlässigt haben. Scalzi bewegt sich dabei auf dem schmalen Grat zwischen Sarkasmus und Parodie, wenn es sich um das klassische und damit auch klischeehafte Verhalten der öffentlichen Stellen außerhalb der üblichen Tricksereien und Tarnungen handelt. Seinem Protagonisten fehlt allerdings in diesen nicht unbedingt relevanten, aber den technischen Hintergrund aufhellenden Passagen eine klare, vielleicht auch zynische Stimme des Film Noir. Shane ist in dieser Hinsicht vielleicht eine tragische, aber nicht immer nachhaltig tragende Figur. Stattdessen präsentiert der Autor einige erheiternde Passagen in einem grundsätzlich eher dunklen Roman, wobei er sich der Tragweite des ersten aufgefundenen Toten erstaunlich bewusst ist und die Tragik insbesondere gegen Ende der Geschichte sehr gut, sehr emotional und vor allem nicht kitschig erzählen kann.
Zusammengefasst ist „Das Syndrom“ vielleicht Scalzis inhaltlich reifste Arbeit, wobei die äußere Hülle des Kriminalromans eher als Kompromiss gegenüber den Lesern angesehen werden muss und dazu dient, diese nicht immer dreidimensionale und bis in letzte Detail durchdachte, aber tragisch originelle Welt mit verschiedenen Arten von „Leben“ zu erfüllen.
- Taschenbuch: 400 Seiten
- Verlag: Heyne Verlag (13. Juli 2015)
- Sprache: Deutsch
- ISBN-10: 3453316606
- ISBN-13: 978-3453316607
- Originaltitel: Lock in
