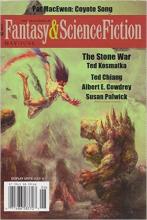
Der Themenschwerpunkt dieser Sommer 2016 Ausgabe liegt weniger im Bereich Science Fiction, sondern auf Urban Horror oder Alternativ Fantasy.
“More Heat Than Light” von Charlottwe Ashley spielt im gleichen Paralleluniversum wie ihre Abenteuergeschichte „La Heron“ aus dem letzten Jahr. Dieses Mal geht es um einen anders verlaufenden Unabhängigkeitskrieg in den USA. Lieutnant Davy ist aus Frankreich geflohen und schließt sich den Rebellen an. Er verwundet einen britischen Offizier und nimmt ihn gefangen. Dieser gibt sein Wort, nicht zu fliehen. Seine Vorgesetzten sind nicht damit einverstanden und drohen mit Bestrafung. Ohne in die Tiefe zu gehen oder den Interessenkonflikt am Ende zufriedenstellend zu lösen lebt die Story in erster Linie von den gut gezeichneten Figuren. Die Originalität von „La Heron“ wird aber nicht erreicht.
In den Bereich der Fantasy kann die Titelbildgeschichte „The Stone War“ eingeordnet werden. Ted Kosmatka beschreibt in einem Sagenstil die Legende um eine gigantische Steinstatue, die zum Leben erwachen und ihre Angreifer töten kann. Dieses Machtübergewicht könnte einen König zum Leichtsinn verleiten, wenn nicht die Gegner über die gleiche Waffe verfügen. Teilweise ein wenig belehrend gegen Ende der zu langen Handlung beschrieben zeigt der Autor auf, dass Weisheit und Demut die besseren Wegweiser in Bezug auf eine auszuübende Macht sind.
Eine Mischung aus X- Files, der Urban Fantasy und Anspielungen auf Fantasy Serien wie Harry Potter präsentiert „Coyote Song“ von Pat MacEwan. Mit einem subversiv humorvollen Unterton geschrieben packt die Autorin neben einer Reihe von modernen Mythen originelle Grundideen so intensiv zusammen, dass der Leser dem seltsamen Mordfall gleich zu Beginn der Geschichte fast aus den Augen verliert. Neben den dreidimensionalen, allerdings auch bizarren Charakteren beginnend mit der Ich- Erzählerin, die zwischendurch ihr Leben verliert, überzeugt vor allem auch die vielschichtige Gestaltung des Hintergrunds. Die Autorin hat sehr viel Erfahrungen mit Minderheiten im angeblich so sonnigen wie paradiesischen in ihren Geschichte gepackt. Hinzu kommt ihre indianische Herkunft, die es ihr ermöglicht, vor allem eine Reihe von eher unbekannten volkstümlichen Mythen ohne zu belehren sehr natürlich in den rasant gestalteten Plot einzubauen. In mehrfacher Hinsicht ein wunderschöner Höhepunkt dieser Ausgabe. Wäre das Ende ein wenig besser strukturiert und würde nicht auf eine „Deus Ex Machina“ Lösung zurückgreifen, dann wäre die Geschichte zumindest ein Kandidat für die „Year´s Best“ Anthologien.
Drei Geschichten dieser Ausgabe lassen sich in den Bereich des Horrors zählen. Da wäre „Steamboat Gothic“ von Albert E. Cowdrey, der sehr ausführlich und stilistisch überzeugend vom Mord an mehreren Hollywood Filmeschaffenden oder Künstlern schreibt, die in einem abgeschiedenen Geisterhaus über längere Zeit getötet worden sind, während sie einen semidokumentarischen Film drehen wollten. Cowdrey konzentriert sich ausschließlich auf die Stimmung und gibt dem Leser keinen Hinweis auf mögliche übernatürliche Phänomene, so dass der Plot unrund erscheint. „Ash“ von Susan Palwick ist die Geschichte einer Frau, die sich nach dem Brand in ihrem Haus mit einem Neubau in der Nähe eines alten Baums kontinuierlich verkleinert. Der Leser ahnt schon, wie der Plot ausgehen wird. Obwohl voller vordergründiger Altersweisheit und einigen Seitenhieben auf die bedingungslose Konsumgesellschaft mit einem Appell, nicht zu verzichten, aber zumindest sorgfältig zu wirtschaften kann der Spannungsbogen aufgrund der bekannten, aber auch für das Genre markanten Züge nur bedingt überzeugen. Aus diesem Subgenrebereich ist “The Secret Mirror of Moriyama House “ von Yukimi Ogawa die beste Geschichte dieser Ausgabe. Die Erzählerin begegnet einer alten Frau, welche die Toten für den Übergang von ihrem unmittelbaren Tod in die nächste Ebene präpariert. Dabei geht sie wie ein Arzt vor. Was sich bizarr anhört, wird sehr überzeugend beschrieben. Der im Titel angesprochene Spiegel dient dabei weniger als einfaches Portal, sondern als Medium. Neben den minutiös gezeichneten Charakteren ist es vor allem die stimmige Atmosphäre, welche diese Story aus der Ausgabe positiv heraushebt.
"The Nostalgia Calculator" von Rich Larson ist eine dieser kurzweiligen Geschichten, die mit der Zeit dem Leser ans Herz wachsen. Die Grundidee ist wundervoll simpel. Der Abstand zwischen einem augenblicklichen Geschehen, dem Entstehen des Gegenstandes und seiner Betrachtung als „nostalgisch“ wird immer kürzer. Wissenschaftler haben errechnet, dass in es kürzester Zeit keinen Abstand mehr zwischen dem „jetzt“ und dem „nostalgisch“ geben wird. Mit fatalen sozialen Folgen. Eine Verschwörung möchte verhindern, dass diese Tatsache ans Licht der Öffentlichkeit gerät. Die Idee ist so bizarr, so verschroben, das der Leser nicht mehr dem kurzweilig zu lesenden, aber viel zu offen endenden Geschehen folgt, sondern der Fokus alleine auf dem immer kürzer werdenden Abstand liegt.
“Last of the Sharkspeakers” von Brian Trent ist eine sehr interessante Geschichte mit einer faszinierenden Ausgangsidee. In seiner fernen Zukunft verfügen die Menschen über organische Raumschiffe. Diese Prämisse ist nicht mal zu neu. Aber die Raumschiffe sind gigantische Haie. Es kommt zu einem Konflikt zwischen zwei menschlichen Gruppen. Während die Stadtleute am liebsten die Haie „abschaffen“ möchte, sehnen sich mehr und mehr Menschen, zu den Sternen zurückzukehren. Tacan gehört zu einer kleinen Gruppe von Menschen, die eher telepathisch als expressiv mit den Haien Kontakt aufnehmen können. Er steht zwischen beiden Lagern. Brian Trent hat seine Welt überzeugend ausgestaltet und legt auf die vielen kleinen Details Wert, vor deren Hintergrund sich eine stimmungsvolle, nachdenklich stimmende Evolutionsgeschichte entwickelt.
Eine zweite Story “The Long Fall Up” von William Ledbetter setzt sich mit der frühen Evolution, dem ersten echten Schritt des Menschen in den Weltraum auseinander. Eine Frau setzt sich von ihrem Arbeitgeber, einem Konglomerat, ab. Sie will ihr Kind in einem Raumschiff in Nullschwerkraft gebären und damit ein provokantes Zeichen setzen. Die Firma schickt ihr einen professionellen Killer hinter her, da sie es als widerwärtiges Experiment ansieht, das deren absolute Autorität untergräbt. Die künstliche Intelligenz an Bord setzt sich über verschiedene Anweisungen hinweg, der Killer zeigt Emotionen und das ein wenig pathetische, aber auch vorhersehbare Ende wird vom Autoren gut beschrieben. Im Vergleich zu einigen anderen, vor allem auf der zwischenmenschlichen Ebene sehr viel besseren Geschichten dieser Ausgabe ragt „The Long Fall up“ leider nicht aus der Masse heraus. In einigen anderen „The Magazine of Fantasy and Science Fiction“ Nummern wäre es eine sehr gute Geschichte gewesen.
Experimentell geht es in „Caribou: Documentary Fragments“ von Joseph Tomaras zu. Eine junge Frau leidet unter einer Manipulation des Gedächtnisses. Anscheinend sind Teile „gelöscht“ worden, wobei der Autor nicht auf die Details eingeht. Der Leser verfolgt nur auf Augenhöhe der Protagonistin die Folgen, wobei der Autor am Ende nicht in der Lage ist, die Effekte wirklich aufzuklären. So wirkt die Geschichte wie der Titel suggeriert wie ein Fragment, das überambitioniert, aber nicht wirklich zufriedenstellend ist. Die Idee, das ein Dokumentarfilmer hinter die Wahrheit zu kommen sucht, ist bei einer Kurzgeschichte schwerer umzusetzen als bei einem Kino- oder Fernsehfilm.
Eine der kürzesten Geschichten ist gleichzeitig eine der besten. „The Great Silance“ hat Ted Chiang für die Ausstellung einer Künstlerin als begleitender Text geschrieben. Es geht um die Suche nach intelligentem Leben im All als Kontrast zu den Papageien auf Puerto Rico, deren Lebensraum von den Menschen systematisch zerstört wird. Ergreifend, pathetisch, nachdenklich stimmend, intelligent und pointiert werden diese fünf Seiten - nicht als Abrechnung verstanden - dem Leser lange im Gedächtnis bleiben und die Sinnlosigkeit des menschlichen Handelns überdeutlich aufzeigen.
Elizabeth Hand und Charles de Lint teilen sich die Buchkritiken untereinander auf. Dabei sind die ausführlichen Anmerkungen der populären Autorin deutlich gehaltvoller als Charles de Lint teilweise Schwärmereien. David J. Skal konzentriert sich zum ersten Mal auf eine Fernsehserie. Die Amazon Adaption von „The Man in the High Castle“. Der Autor vergleicht Dicks Vorlage mit der Fernsehserie, arbeitet die Ähnlichkeiten und Unterschiede sehr gut heraus, um zu einem ausgesprochen positiven Fazit zu kommen.
Zusammengefasst ist die Mai/ Juni Ausgabe einer der stärksten Nummer unter dem noch jungen Herausgeber C.C. Finlay. Sehr viele Themen werden abgedeckt, wobei auch Wert darauf gelegt wird, dass es in den einzelnen Texten menschelt.
The Magazine of Fantasy and Science Fiction May/ June 2016
Taschenbuch, 255 Seiten
