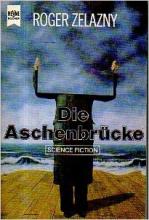
Roger Zelaznys 1976 veröffentlichter Roman “Die Aschenbrücke” ist schwierig qualitativ einzuordnen. Während viele seiner frühen Arbeiten außerhalb der klassischen Kurzgeschichten schon mit Realitäten und Irrealitäten gespielt haben, erscheinen einige der Plotelemente fast wie nicht zu Ende gedachte Variationen seines Buches „Heute wählen wir Gesichter“. Hinzu kommt, dass Roger Zelazny vielleicht unabsichtlich und weniger experimentell auf die A.E. van Vogt Methode zurückgegriffen hat. Das Buch wirkt wie aus verschiedenen, thematisch nicht miteinander verbundenen Kurzgeschichten zusammengesetzt, die für sich alleine überzeugen können, aber die humanistischen Ideen stehen zum Beispiel den klassischen SF Elementen konträr gegenüber.
In beiden Büchern werden die Menschen im Allgemeinen entweder wie im vorliegenden Band manipuliert oder wie in „Heute wählen wir Gesichter“ seit einer nicht näher bestimmten Zeit in einem sogenannten „Haus“ eingesperrt, um intellektuell zu reifen.
Im vorliegenden Buch ist die sich wie ein roter Faden durchziehende Grundidee, das die Menschen seit vielen Jahrtausenden von Außerirdischen nicht unbedingt manipuliert, sondern durch eine kontinuierliche Veränderung ihrer ökologischen Lebensbedingungen zum Aussterben verurteilt werden. Mit dieser Prämisse rechnet Zelazny ein wenig zu milde mit seinen Mitmenschen und ihrer grenzenlosen Expansionslust ab. Interessant ist zusätzlich, dass Zelazny die Idee der Überbevölkerung gänzlich ignoriert.
Am Ende dieses anscheinend seit Äonen laufenden Prozess wollen die Außerirdischen eine Atmosphäre, eine Welt erschaffen haben, auf der sie leben können. Die Menschen sollen nicht unbedingt nur aussterben, sondern die schädlichen Einflüsse sollen sie dazu verleiten, sich gegenseitig in Kriegen umzubringen. Wie in vielen anderer seiner Science Fiction Werke nutzt Roger Zelazny diese Idee ausschließlich als Versatzstücke, als Hintergrundinformationen, um davor humanistische Dramen ablaufen zu lassen. Nur in „Fluch der Unsterblichkeit“ – hier besuchen die Fremden die Erde, um sich einen Eindrang vom intellektuellen Stand der Menschen in Form einer Art Weltreise zu den klassischen Stätten der Kultur – versucht der Autor die Grundidee eines Konflikts zwischen Menschen und allmächtigen, Götter gleichen Außerirdischen fokussiert zu Ende zu bringen.
In „Tore in der Wüste“ hat Zelazny auch die Idee der allgegenwärtigen, die Menschen fordernden Außerirdischen allerdings in einer komischen, unterhaltsamen Art und Weise aufgegriffen. In „Tore in der Wüste“ gibt es eine Art Schnitzeljagd, welche den Protagonisten als Stellvertreter der Menschheit zeigen soll, wie weit der Einfluss der Fremden wieder wie in „Fluch der Unsterblichkeit“ eher als Hüter der Menschen wirklich reicht.
Die Fremden sind aber nicht alleine. Es gibt einen dunklen Mann, der für seine eigenen Ziele zu arbeiten scheint. Der Auftakt des Romans ist in dieser Hinsicht am Effektivsten. Er will, dass eine bestimmte Resolution von den Vereinten Nationen durch gewunken wird. Dazu plant er ein Attentat auf einen der wichtigen Entscheider, um mittels der aufkommenden Märtyrerstimmung jegliche Opposition zu erdrücken. Der Plan steht unmittelbar vor der Umsetzung, bevor er es sich anders überlegt.
Die zweite Handlungsebene ist dagegen faszinierender und wirkt wie eine Art Gegenentwurf zu Robert Silverbergs „Es stirbt in mir“. In diesem bahnbrechenden Roman verliert ein Telepath sehr langsam seine Fähigkeit, während in Robert Zelaznys Buch das Kind zweier Telepathen im Mittelpunkt der Handlung steht. Dennis Guise hat nicht nur die Fähigkeit seiner Eltern geerbt, er ist wahrscheinlich der stärkste Telepath der Welt. Allerdings lesen Zelaznys Telepathen weniger Gedanken als das sie diese empfinden. Sie werden quasi zu den Menschen. In einer beeindruckenden Abfolge von kurzen Vignetten versucht Dennis Guises Mutter immer wieder ihren Sohn vor diesen Eindrücken zu schützen, in dem sie ihn weiter isoliert und schlafen legt. Hinzu kommen immer wieder Umzüge, deren Gipfel ein Aufenthalt auf dem Mond ist, wo nur wenige Menschen leben. Zu diesem Zeitpunkt hat er beginnend mit seiner Reise aus dem Südwesten der USA die Fähigkeit, jeden Geist auf der Erde zu erreichen. Im Umkehrschluss verlässt er allerdings auch seinen katonischen Zustand durch die Eindrücke schon im Mutterleib und beginnt sich für die anderen „Geister“ aktiv zu interessieren.
So intensiv und emotional diese einzelnen Szenen auch beschrieben worden ist, Roger Zelazny geht einen unerklärlichen und leider auch unerklärten Schritt weiter. Am Ende kann Dennis Guise auch in die Geister historischer Persönlichkeiten schlüpfen. Dabei reicht das Spektrum von Zelaznys antiken Favoriten wie Archimedes über Jean Jacques Rouseau bis Leonardo da Vinci. Wie der ganze Roman sind diese Übernahmen der bekannten Persönlichkeiten nicht chronologisch geordnet. Auch wenn der Hintergrund dieser innovativen Fähigkeit nicht weiter erläutert worden ist, gelingen Zelazny auch sprachlich einige intensive wie belehrende, zutiefst humanistische Passagen, in denen die großen Geister ihre Erfahrungen dem lernwilligen, aber auch überforderten Dennis Guise in Form brillant geschriebener Monologe weiterreichen.
Im Gegenzug beginnt Dennis Guise immer verzweifelter seine ursprüngliche Persönlichkeit zu suchen. Durch diesen Bogenschlag erinnert der Plot wieder an die tragische Geschichte des Telepathen in „Es stirbt in mir“.
Die größte Kritik an „Die Aschenbrücke“ liegt in der experimentellen Struktur des Romans, die hinsichtlich der intimen Handlung kontraproduktiv ist. Kein Anfang, kein Ende und dazwischen eine Reihe von eher wie Anekdoten erscheinende, aber überzeugend geschriebene Szenen. Roger Zelazny versucht zu viel in zu wenig Romantext zu pressen. Die Idee der Außerirdischen, welche die Erde verseuchen, ist vor allem aus dem Zeitalter des noch andauernden kapitalistischen Fortschritts kommend interessant und hätte eine klassischere und damit auch zugänglichere Behandlung verdient.
Unabhängig von der ambivalenten Nutzung der Telepathie Idee rührt das Schicksal des jungen Dennis Guise den Leser mehr. Es ist schade, dass ein Stilist wie Zelazny diese beiden Handlungsbögen nicht zu einem zufriedenstellenden Abschluss geführt hat, da in erster Linie die Verknüpfen zwischen ihnen erstaunlich starr und konstruiert erscheinen.
Es ist schade, dass Roger Zelazny sich nicht auf eine der beiden Geschichten konzentriert hat, um einen weniger gewollt experimentellen, sondern angesichts seiner vielen ideen zugänglichen Roman zu schaffen.
Heyne Verlag
Taschenbuch, 139 Seiten
- ISBN-10: 3453305213
- ISBN-13: 978-3453305212
