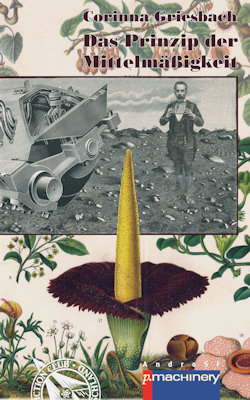„Das Prinzip der Mittelmäßigkeit“ ist der erste Roman aus der 1967 in Spanien geborenen Corina Griesbach im Verlag p. machinery. Thomas Franke hat dem durchaus sozialkritischen Plot ein seinem Stil entsprechenden Titelbild verliehen. Corinna Griesbach gibt neben ihren Veröffentlichungen in den Bereich Krimi, Horror und Science Fiction auch seit 2009 die Literaturzeitschrift HALLER heraus.
In Interviews hat sie gesagt, dass der ursprüngliche Texte schon aus dem Jahr 2006 stammt, aber für die anstehende Buchveröffentlichung grundlegend überarbeitet worden ist.
Grundsätzlich nutzt die Autorin markante, aber auch bekannte Sujets des Genres. Zeitreise, heimliche Chronisten in der irdischen Vergangenheit; später eine Art Entführung in eine dunkle Zukunft, dazu Warnungen vor der weiteren Vergiftung der Erde durch die Menschheit; die Idee von Generationenraumschiffen oder Archen im Orbit um die Erde. Dabei wird „Technik“ eher ambivalent eingesetzt. Die Autorin geht nicht in die Details, der Protagonist selbst nutzt Erfindungen wie das ihn begleitende Auge eher pragmatisch; ist aber ohne diese gänzlich hilflos.
Grundlegend geht Corinna Griesbach eher opportunistisch vor. Am Ende der Geschichte schließt sich zwar ein Kreis, aber der Weg dahin mit einigen Gabelungen wird nicht gänzlich zufriedenstellend abgeschritten. Immer wieder setzt sie markante Eckpunkte, ohne diese weiter zu erläutern oder Hintergrundinformationen zu präsentieren. Da reicht die Erklärung nicht, der Protagonist H´Thüsos Maisyn ist das futuristische Ebenbild eines zerstreuten Professors oder besser eines Historikers, der vor allem in seine Gegenwart und damit der fernen Zukunft viele Aspekte als gegeben hin und präsentiert sie auch in dieser Form stellvertretend durch eine Protagonistin so den Lesern. Damit wird aber die ursprüngliche und sich auch im Titel wiederfindende Ausgangsbasis ignoriert. „Das Prinzip der Mittelmäßigkeit“ als eine Art Idealform.
Maisyn reist aus der Zukunft wahrscheinlich nicht nur in die umwelttechnisch schockierend extrapolierte Gegenwart mit ihren Katastrophen und vor allem einer sich mehr und mehr ausbreitenden ökologischen Katastrophe, welche den Planeten für die Menschen bald unbewohnbar machen wird. Aus seinen Augen lernt der Leser die Erde auf eine ungewöhnliche Art und Weise kennen. Der Auftakt ist der stärkste Abschnitt des ganzen Romans. Maisyn beobachtet und hilft manchmal auch pragmatisch den Menschen, die durch die Naturkatastrophen manchmal nicht zum ersten Mal ihr ganzes Hab und Gut verloren haben. Verstörend ist die Szene, wenn Maisyn schweigend mit einem Brett neben einem Hausbesitzer den Schlamm zu beseitigen sucht, den eine Flutwelle hinterlassen hat.
Begleitet wird dieser erste Reise in eine fremde und doch unbestimmt wie unheimlich vertraute Welt durch Meldungen wie immer mehr ausgestorbene Tierarten; Füchse, die sich in den von Menschen verlassenen Städten niedergelassen haben oder wie angesprochen den verschiedenen Katastrophen, kumulierend in der Möglichkeit, das der ganze Weltraumschrott auf die Erde fällt und dort viele Menschen tötet.
In dieser Welt sucht Maisyn nach dem Prinzip der Mittelmäßigkeit vor allem hinsichtlich einer entsprechenden Frau. Zu den tragisch humorvollen Passagen gehört, als eine dieser Frauen die Aufzeichnungen des Historikers liest und sich wegen dessen auf den ersten Blick kompromittierenden Äußerungen brüskiert fühlt. Aber die Idee, etwas im Grunde Unscheinbares, Mittelmäßiges und deswegen vielleicht weder in das eine noch das andere Extrem Verfallendes zu finden , ist faszinierend. Es stellt sich die Frage, ob mittelmäßige Menschen oder ein durchschnittliches Wachstum die ökologischen Exzesse oder die politischen Extreme hätte verhindern können. Aber die Autorin führt diesen Gedanken nicht konsequent genug weiter. In der Zukunft wird dieser fast obsessive Gedanke Maisyn noch zu einer Art Gesetz oder pragmatischen Notwendigkeit, sondern im Grunde ignoriert. Selbst die Aufgaben, welche die Frauen aus der Gegenwart in der Zukunft übernehmen sollen, ist genretechnisch nicht besonders originell oder innovativ. Hier wäre es sinnvoller gewesen, den titeltechnischen roten Faden konsequenter und vor allem auch exotischer weiterzuführen und den Roman eben auf dieser anfänglich etablierten Linie abzuschließen.
Es ist wahrscheinlich die größte, aber auch bis auf die nicht abgeschlossenen roten Fäden einzige nachhaltige Schwäche des Buches.
Nicht zufriedenstellend ist die Zukunft. Sie ist dunkel, nihilistisch. Maisyns Kollegen und Mitmenschen leben am Ende der rücksichtslosen Expansion und müssen mit einer im Grunde toten Erde fertigwerden. Auch eine klassische Fortpflanzung ist nicht möglich. Die Autorin impliziert, dass Maisyn und andere Menschen aus der Zukunft die Augen gefunden haben und die Zeitreisetechnik eher ein Zufallsprodukt ist, aber hinsichtlich der Genetik oder vor allem der künstlichen Befruchtung oder im Notfall des Ausbrütens außerhalb des Mutterleibs bleibt vieles unausgesprochen oder die Autorin impliziert sogar einen Rückschritt gegenüber der Gegenwart, um ihre konstruierte Pointe zu untermauern, aber objektiv gesprochen zu negieren. Es gibt keine überzeugenden Erklärungen. Die Idee, dass einzelne Zeitreisende Erfolge haben, aber andere nicht und das alles überhaupt den von Maisysn eher euphemistischen, aber realistischen zitierten Zukunftsplan am Leben erhält erscheint höflich gesprochen absurd. Das hat die Autorin in ihrem sehr kurzen Epilog auch erkannt und eine weitere bekannte Facette des Science Fiction Genres fast entschuldigend hinterher geschoben.
Zu den Stärken des Buches gehört nicht nur eine warmherzige, vielschichtige Zeichnungen der Protagonisten, wobei einzelne Nebenfiguren wie der Richter und seine Frau Bea – Eltern von Maisyns Ziel der Begierde Catrin – eher eindimensional schematisch den Ereignissen passend gezeichnet worden sind. Corinna Griesbach präsentiert die Geschichte in einem sehr auffälligen, passenden und intimen Stil, obwohl sie den Handlungsbogen komplett aus der Perspektive der dritten Person erzählt.
Interessant sind die einzelnen kleinen und größeren Fehler, die Maisyn unterlaufen. Dabei reicht das Spektrum von der Beinahe-Katastrophe der verschwundenen Augen – diese geheimnisvollen Fundstücke der zukünftigen Vergangenheit bleiben hinsichtlich ihrer Fähigkeiten und Herkunft ein Rätsel – bis zu der Begegnung mit den Traditionen. Der Streuengel aus dem Rosviertel Aachens sei hier expliziert genannt. Oder die Begegnung mit dem anscheinend inzwischen geschlossenen Laden für UFO Anhänger. Maisyn hat einen Sinn für überflüssigen Kommerz oder Kapitalismus im Allgemeinen, so dass er auch nicht im Gegensatz zum Leser unterscheiden kann, welche Bedeutung diese Geschäfte oder Traditionen haben. Ohne den im Grunde zeitreisenden Fremden lächerlich zu machen oder seine Mission zu entwerten erzählt die Autorin eine grundsätzlich sehr ernste Geschichte beschwingt und vor allem trotzdem nachdenklich stimmend.
Die Liebesgeschichte zwischen Maisyn und Catrin wirkt allerdings auch bemüht. Der Funke will nicht überzeugend genug überspringen, zumal der Zeitreisende sie im Grunde auch belogen hat. Die Gegenwart ist schlimm, die Zukunft düster, aber ausgerechnet in dieser nihilistischen Zukunft ohne eine nachhaltige Überlebenschance für sie landet Catrin ja an der Seite des Opportunisten Maisyn, der mehr seine Mission erfüllen als sie wirklich umgarnen will. Catrin ergreift dann aus dem Nichts heraus eine Initiative, aber die Autorin hat sichtlich Schwierigkeiten, die Originalität, die Sprachgewalt und vor allem auch das absurde Prinzip der Mittelmäßigkeit konsequent weiter zu extrapolieren.
Auf jeden Fall ist „Das Prinzip der Mittelmäßigkeit“ ein grundlegend origineller, herausfordernder und doch gleichfalls auch unterhaltsamer Roman mit teilweise sehr bekannten Facetten, die ein wenig anders präsentiert worden sind. Der Text ist nicht perfekt, aber ambitioniert. Und das alleine ist die Lektüre wert.