„Sonnenbrand“ ist die erste Storysammlung Peter Mathys. Die hier versammelten Geschichten umfassen einen Veröffentlichungszeit von dreiundsechzig Jahren, mehr als manches Leben. Das wirkt auf den ersten Blick beeindruckend, auf den ersten zweiten hat der 1941 geborene Schweizer die letzte Geschichte dieser Anthologie 1959 im „Utopia Magazin“ 25 veröffentlicht. Alle anderen Texte stammen aus dem 21. Jahrhundert. Die Hälfte der Geschichten sind Erstveröffentlichungen. Am Ende der Anthologie findet sich ein kurzer, aber einprägsamer Lebenslauf des Autoren.
Während die frühste veröffentlichte Geschichte also den Abschluss der Anthologie bildet, ist „Der Schwarm“ von der Entstehung her eine der jüngsten Arbeiten. An dieser Story lassen sich die Stärken und Schwächen des Autoren sehr gut ablesen. Zu den Stärken gehören die Dialoge. Sie wirken immer natürlich und pointiert. Leider schafft es Peter Mathys nicht, seinen Protagonisten das entsprechende emotionale Werkzeug mit auf die Reise zu geben. So nehmen die Wissenschaftler in „Der Schwarm“ die mögliche Erkenntnis pragmatisch stoisch hin, das die Viren aus dem Weltall stammen könnten. Michael Crichton hat da in „Andromeda“ ganz anders reagieren lassen. Manches erinnert an den Ausbruch der Corona Epidemie mit den nicht erklärlichen Symptomen. Der Leser ist aber den Protagonisten immer einen Schritt voraus, weil Peter Mathys auf der zweiten Handlungsebene die leider sehr ambivalenten Interessen des Schwarms erklären lässt. Der Plot wirkt in der vorliegenden Form leider nicht zum letzten Mal hinsichtlich der Konzeption antiquiert, die Spannungskurve wird auch nicht konsequent genug aufgebaut.
„Ameisen“ erschien zum ersten Mal im Jörg Weigand Geburtstagsband und ist eine der längsten Geschichten dieses Jubiläumsbandes, sondern auch der vorliegenden Anthologie Eine First Contact Geschichte mit intelligenten Ameisen aus dem Tiefen des Alls auf der Suche nach einer neuen Heimat. Der Autor gibt sich Mühe, die Insekten vor allem sympathisch zu zeichnen, wobei der Pointe sich relativ frühzeitig abzeichnet und der Autor in der stilistisch allerdings sehr ansprechenden Geschichte abschließend nur im Detail neue Facetten der bekannten First Contact Thematik hinzufügen kann.
„Balsamäpfel“ und Schwarzweiß“ bauen aufeinander auf. Nicht umsonst hat Peter Mathis die beiden Kurzgeschichten mit dem Planeten untertitelt, auf dem sich das Objekt der Begierde befindet: die seltenen Balsamäpfel. Die erste Geschichte erinnert vom Aufbau her an die klassischen Abenteuerstoffe, die Expeditionen ins Unbekannte, die Haggard oder Kipling vor mehr als einhundert Jahren geschrieben haben. Ein Mann schließt sich einer wenig nachhaltig organisierten Expedition an, um Reichtum zu erlangen. Am Ende steht er zwar nicht mit leeren Händen dar, aber geläutert. Der Planet ist exotisch beschrieben, die Balsamäpfel mit ihrer ambivalenten Wirkung sind bei den Schönen und Reichen sehr begehrt. „Schwarzweiß“ baut auf der Idee der wertvollen Balsamäpfel auf. Im Grunde will eine neue Expeditionsleiterin den Überlebenden aus „Balsamäpfel“ verpflichten. Es soll aber nicht mehr nur eine Ernte werden, man plant eine Kolonie auf der abgeschieden gelegenen Welt und hat sogar das entsprechende Land gekauft. Eine wichtige Komponente aus „Balsamäpfel“ wird dafür nicht weiter diskutiert. Auch erlebt der Protagonist eine weitere Auswirkung der Äpfel anscheinend in Kombination mit Alkohol. Auch in diesem Punkt versucht Peter Mathys mit einer wirklich sehr alten Idee den Leser zu überraschen. Aber die Geschichte wirkt wie in der Mitte gebrochen, die Wendung ist erstens zu abrupt und wenn man schon rassistische Klischees durchspielen möchte, dann sollte ein Autor die ganze Klaviatur benutzen und nicht bei der erstbesten Gelegenheit alles wieder zurückdrehen, wobei einer der Schurken reumütig seine Tat noch begründen sucht. Anstatt die fremde Welt weiter zu erforschen oder wirklich die Schwierigkeiten einer Expedition auf einem höflich gesprochen nicht freundlichen Planeten zu erforschen, verfällt der Autor zum wiederholten Male in Klischees und beraubt sich unglücklich der Effektivität seiner Texte.
Die Titelgeschichte „Sonnenbrand“ spielt ebenfalls wie einige der hier gesammelten Texte auf zwei Ebenen, die nicht immer überzeugend zusammengefügt worden sind. In einer fernen Zukunft verbrannt die Sonne die Erde, sie ist unbewohnbar geworden. Die meisten Menschen sind ums Leben gekommen, durch eine rechtzeitige Evakuierung konnte ein Teil der Menschheit gerettet werden. Ein primitiver Kult, dessen Wurzeln der Leser erst am Ende der Geschichte erfährt, lebt unter primitiven Umständen unter der Erde. Die Sternenmenschheit schickt eine Expedition aus, um die Überlebenden zu bergen.
Die Grundidee ist wissenschaftlich eher bemüht konstruiert, sorgt aber für Spannung. Auf der zweiten Handlungsebenen wird von dem Raumschiff berichtet, das zur Erde aufbricht, um Menschen zu retten. Hier greift Peter Mathys auf die Mechanismen der fünfziger und sechziger Jahre Science Fiction zurück. Die Pointe ist solide, wirkt ein wenig ironisch. Aber das Tempo des ganzen Textes ist nicht sonderlich hoch und wie bei zum Beispiel „Das Spiel“ wird einer der Protagonisten im entscheidenden Moment quasi von außen gerettet.
„Annas Garten“ wirkt am Anfang sehr interessant und atmosphärisch überzeugend. Die ältere Protagonistin lebt seit dem Tod ihres Mannes alleine in dem Haus mit dem großen Garten. Eines Tages erhält sie eine seltsame Anfrage. Testamentarisch hat der Vorvorbesitzer darum gebeten, das seine Asche im Garten verstreut wird. Anna willigt ein, auch wenn anschließend seltsame Phänomene passieren. Am Ende dreht der Autor einmal die Handlung auf links mit einem Science Fiction Element, das in dieser Form eher an eine literarische Form von „Planet 9 aus dem Weltall“ erinnert, um während der Pointe ein subversives, aber nicht wirklich gut vorbereitetes böse Ende zu präsentieren. Die erste Hälfte der Geschichte ist nicht nur stilistisch, sondern auch inhaltlich eine der beste Erstveröffentlichungen dieser Anthologie. Das Ende wirkt leider zu sehr bemüht.
„Das Spiel“ stellt zwei konträre Welten gegenüber. Dabei wirkt die Heimwelt für ein Paradies der geordneten Langeweile, während die Spielwelt an eine Mischung aus Dystopie, aber auch Kommunismus erinnert. Wie bei „Sonnebrand“ erfolgt die Rettung der Protagonistin aus einer unangenehmen Situation in letzter Minute. Nicht ganz klar ist, ob diese hierarchisch strukturierte, an ein riesiges Gefängnis mit sadistischen Wärterinnen erinnernde Spielwelt tatsächlich virtuell ist oder die Protagonistin sich dieses Alptraum im Grunde während ihres Spaziergangs im Geiste zusammenstellt. Der dunkle Tenor der ersten Hälfte ist zufrieden stellend, auch wenn Peter Mathys absichtlich oder zufällig fast jedes Klischee der antiutopischen Diktator in Kombination mit unzähligen Gefängnisfilmen in primitiven dritten Welt Ländern spielend abarbeitet. Das Ende ist zu abrupt, wirkt zu glatt gebügelt, aber generell eine solide Kurzgeschichte.
Auch Peter Mathys allererste Geschichte „Die Weltraumkapseln“ setzt sich mit besonderen Gefängnissen auseinander. In der Zukunft werden Kapitalverbrechen durch Abschuss in einer engen Raumkapsel ins All bestraft, auch wenn es offiziell keine Raumfahrt mehr gibt. Der Protagonist verfügt über Parafähigkeiten, deren Einsatz in der Zukunft verboten ist. Auf dem Flug durchs All kann er in die Gedanken einer Frau eindringen, die wenige Tage vor ihm ins All geschossen worden ist.
Der Plot wird gut entwickelt. Gegen Ende muss Peter Mathys seine provokante Ausgangsthese ein wenig relativieren und einzelne Komponente begradigen. Das macht er in Form einzelner Ideen, die inzwischen dem Leser aus anderen Werken vertraut sind, aber Ende der fünfziger Jahre vor allem für die Magazin Science Fiction durchaus überraschend wie provozierend zu gleich erscheinen. Stilistisch gibt es keinen Unterschied zwischen diesem Frühwerk und den erst 2020 entstandenen Science Fiction Geschichten dieser Anthologie. Diese Tatsache kann positiv, bei den neueren Texten aber auch ein wenig negativ gesehen werden, da sich Peter Mathys bemüht, die überraschenden Wendungen des Erstlings in den späteren Arbeiten mindestens zu erreichen, wenn nicht zu übertreffen. Dadurch wirken die Geschichten manchmal ein wenig zu bemüht. Es ist aber rückblickend ein beeindruckendes Debüt eines gerade achtzehn Jahre alten jungen Mannes.
Aus der „2084“ Anthologie stammt „Wahltag 2084“. Der Wahltag des Autors wirkt eher wie ein Expose für eine Novelle oder einen Roman, wobei der Autor dem grundlegenden Thema inklusiv des Bezugs auf Asimovs Robotergesetze keine wirklich neuen Impulse schenken kann. Die Roboter sind die „dominierende“ Klasse in dieser Zukunftswelt. Auch wenn sie weiterhin den Menschen dienen wollen, verlangen sie nach einigen Grundrechten. Das Problem der Geschichte ist, dass Peter Mathys auf der einen Seite eine wichtige Pointe vor dem Leser verstecken möchte, auf der anderen Seite aber die emotionale Seite impliziert, die in einem Widerspruch zu seinem sonstigen Hintergrund steht. Auch Chris Schmidts „Evolution“ setzt sich mit den besseren Menschen auseinander. Aber viele Ideen werden oberflächlich gestreift und wirken nicht ausgereift genug. Dabei bietet diese Story vor allem durch die Doppeldeutigkeit der Protagonisten ausgesprochen viel Potential und hätte vielleicht als kurze, mehrschichtiger aufgebaute Novelle effektiver und vor allem auch pointierter gewirkt.
Im Hans Kneifel Gedächtnisband erschien „Jenseits“ . Grundsätzlich ist es eine stimmungsvolle, ambitionierte Geschichte, deren Ende allerdings genau wie die zugrunde liegende, spätestens nach einigen Seiten erkennbare Struktur nicht neu sind. Der Titel wirkt in diesem Fall zusätzlich kontraproduktiv
Für die Anthologiereihe „Phantastischer Oberrhein“ Jörg Weigands hat Peter Mathys mit „Die Hochzeitsgesellschaft“ die wahrscheinlich beste Story dieser Anthologie. Ein Zug verspätet sich, niemand weiß, wo er abgeblieben ist. Als zwei Kontrolleure die Strecke per Auto und später zu Fuß abgehen, finden sie ein ungewöhnliches Phänomen. Peter Mathys verzichtet im Gegensatz zu einigen anderen Storys dieser Anthologie auf schlüssige Erklärungen und treibt dadurch den Plot als eine Art Geistergeschichte vor sich her. Ein solcher Weg hätte auch „Annas Garten“ sehr gut getan. Die Atmosphäre ist stimmig, die Reaktion der Protagonisten glaubwürdig und wie schon angedeutet die fehlende rationale Aufklärung lässt das Geschehen phantastisch erscheinen.
„Sonnenbrand“ ist eine solide Anthologie mit einer Reihe von zufrieden stellend geschriebenen Science Fiction Geschichten, die aber nicht selten auf klassische, heute manchmal ein wenig klischeehaft wirkende Ideen zurückgreifen. Literarisch sind einzelne Storys im stilistischen Bereich zu gleichförmig geschrieben worden. Es fehlen ihnen sprachlich dynamische Elemente. Auch Jörg Weigand fällt in diese literarische Klasse, aber seine Pointen sind im Durchschnitt deutlich stärker und die Dialoge noch pointierter. Einzelne Texte wie „Die Hochzeitsgesellschaft“ ragen aus den insgesamt elf Storys positiv heraus. Peter Mathys Geschichten demonstrieren den Drang, gute Ideen ein wenig zu pragmatisch und überambitioniert zu präsentieren. Keine der Storys fällt literarisch ab, aber bei einigen Texten harmonieren Grundidee und Ausführung auch nicht gänzlich zufrieden stellend miteinander.
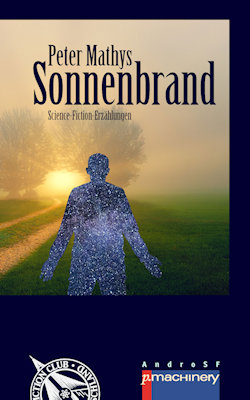
SONNENBRAND
Science-Fiction-Erzählungen
AndroSF 140
p.machinery, Winnert, März 2021, 240 Seiten, Paperback
