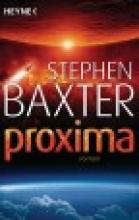
Dem produktiven Briten Stephen Baxter kann man einen Vorwurf nicht machen. Selbst wenn die Prämisse noch so klischeehaft oder antiquiert erscheint, dreht sich der Autor in der Mitte des Plots und präsentiert plötzlich einen existentiellen Roman, der neben den Hinterlassenschaften einer außerirdischen Kultur – die Erbauer – Anspielungen auf „Lost“ – die Lucke, welche mehr Fragen aufwirft als beantwortet - enthält und schließlich mit einem Zeitraffer endet. Kein momentan lebender Science Fiction Autor kann aus dem Stehgreif derartige Szenarien entwerfen. Normalerweise nutzt Stephen Baxter ohne größere Längen seine Inhalte für Trilogien, entwirft den Hintergrund im Auftaktroman, baut eine stringente Handlung im Mittelteil auf und endet mit einem kosmischen Ausblick im Abschlussband. Eine vergleichbare Vorgehensweise hätte „Proxima“ auch gut getan, denn nach einem ruhigen, aber nicht langweiligen Auftakt verschachtelt die Handlung zu viel, während die zwangsverpflichteten Siedler ihre neue Welt auf Augenhöhe der Leser noch kennenlernen müssen. Kaum ist diese Welt in einem frühen Erkundungsstadion, dreht sich die Handlung wieder und Baxter versucht neben einem nihilistisch beendeten irdischen Konflikt zu viele zwischenmenschliche Baustellen aufzuwerfen, die von seinem implizierten kosmischen Gebilde nicht nur ablenken, sondern die Erhabenheit einer neuen Welt, die Eroberung des Planeten aus einer absichtlichen Position der Schwäche im Vergleich zu Robinsons „Mars“ Romanen im Hintergrund verkommen lassen. Der Generationenkonflikt und die Idee, Kinder für die Straftaten ihrer Eltern zu verurteilen sind zwei weitere Themen, die Baxter aufgrund des zur Verfügung stehenden „Raumes“ in seinem Roman nur andeuten kann.
„Proxima“ ist kein schlechter Roman, aber im Vergleich zur „langen Erde“ Serie, welche er zusammen mit Terry Pratchett entwickelt und geschrieben hat, wirkt der Plot wie schon angesprochen zu uneinheitlich, das Tempo zu ambivalent und vor allem die Charaktere ragen über die rudimentären, ohne Frage aber plakativen Zeichnungen kaum hinaus. Mit Yuri der nach achtzig Jahren aus seinem Cryotank geweckt wird verfügt der Roman über eine Figur, die genauso desillusioniert und verwirrt ist wie der Leser. Seine Eltern sind wegen den Stammeskämpfen verurteilt worden. Kurz vor ihrer augenscheinlichen Hinrichtung haben sie ihren Sohn als Schutz einfrieren lassen. Er hat die Erkundung eines erdähnlichen Planeten durch einen einzelnen Astronauten genauso verschlafen wie den Aufstieg Chinas zur ersten Supermacht oder die Experimente auf dem Merkur. Jetzt wird er als potentieller Verbrecher zusammen mit insgesamt vierhundert anderen genetisch ausgewählten Menschen in ein Raumschiff gesperrt, das den im Alpha Centauri aufgefundenen erdähnlich – die Ähnlichkeit scheint sich auf Wasser und eine Sauerstoffatmosphäre bei dieser jungen Welt zu beschränken – nach einem strengen Plan besiedeln soll. Natürlich gegen den eigenen Willen.
Alleine die Grundlagen dieser perfiden Besiedelung machen den Reiz des ersten Romanabschnitts aus. In kleinen Gruppen von vierzehn Männer und Frauen - dabei wird auf eine zahlenmäßige Gleichheit nicht viel Wert gelegt - mit einem beweglichen Roboter als Lehrmeister und Zuchtmaschine als elektronischem „Leitesel“ werden sie über den ganzen Planeten verteilt. Sie sollen sich nicht begegnen, die Kolonien sollen autark aufwachsen. Wie schnell dieser Plan schief geht, zeigt sich natürlich exemplarisch an Yuris Kolonie. Auf einige andere Gruppen geht Baxter in der zweiten Hälfte des Romans ein. Neben Streit um die Frauen ist es die herausfordernde Natur des Planeten, die schnell die Gruppe auf zwei Menschen - Mann und Frau und Roboter - reduziert wird. Es folgt ein kleiner Robinson Crusoe Teil, in dem Yuri nicht nur mit den Schwierigkeiten seiner Beziehung - Sex, keine Liebe - zu kämpfen hat, ein provisorisches Haus baut, eine Tochter bekommt und schließlich auf einer der Expeditionen über die Planetenoberfläche einer anderen Gruppe von ausgesetzten Siedlern begegnet. Die zwischenmenschlichen Passagen sind für einen Baxterroman erstaunlich intensiv geschrieben. Zwar greift er auch auf Klischees mit der Prostituierten zurück, die jeder haben will, die sich aber aus dem Beruf zurückgezogen hat oder zeigt auf, wie egoistisch introvertiert Frauen sein können. Er zeigt eine Art Amazonenstamm mit einem ölig schleimigen Anführer, dessen Schicksal ein Höhepunkt dieses Romans auch hinsichtlich der Effektivität ist, oder deutet an, dass selbst in der Fremde der schlimmste Feind des Menschen er selbst ist. Yuri ist ein sperriger Charakter, der pragmatisch, aber nicht emotional mehr und mehr zu einer Art stillem Held wird. Natürlich ist er anders als seine Mitbewohner. Frauen gegenüber reserviert zurückhaltend, ansonsten entschlossen und stoisch. Da er allen Menschengruppen begegnet, verfällt Baxter in der zweiten Hälfte des Buches allerdings auch in einige belehrend erscheinende Schemata und negiert gute Ansätze.
In diesem relevanten Abschnitt des Romans ist der Planet eher ein wichtiger, fast seinen Bewohnern gleichberechtigter Protagonist. Immer wieder suchen Stürme bestimmte Abschnitte des Planetenoberfläche heim, vor denen sich auch die putzigen Ureinwohner in lebendigen "Höhlen" verstecken. Es gibt "Drachen", die mehr flugfähige Wesen als Mythen sind. Neben der dichten Wolkendecke und den langen Tagen ist eine Idee, dass aufgrund der Klimaschwankungen die Seen wandern. Sie trocknen an einer Stelle aus und bilden sich an einer anderen wieder neu. So ist Yuri mit seiner Frau, seiner Tochter und dem Roboter gezwungen, der Spur des Wassers zu folgen. Diese Abschnitte sind faszinierend, vielschichtig und zeigen eine exotischen, unwirtlichen, aber eroberungswilligen Planeten. Dabei geht Baxter ausgesprochen geschickt vor. Neben der einfachen Handlungsstruktur sind es die kleinen Erfolge, die Yuri im Kampf gegen Ehefrau und Roboter erzielen kann, die "Proxima" zu einer intimen, aber nicht uninteressanten Geschichte machen. Der Plot hätte durchaus weiterlaufen können, zumal Yuri erst langsam die anderen Gruppen wiederfindet. Der Brite geht dabei so routiniert vor, dass er mit den geheimnisvollen Lucken unter der Planetenoberfläche noch zusätzlich eine weitere Idee, vielleicht zu sehr an "Lost" erinnernde Idee einführt. Hier bricht der Plot aber auch ab. Die Besiedelung des Planeten wird quasi "gestoppt" und eine Prämisse eingeführt, die nicht unbedingt zufriedenstellend und überzeugend ist. Diese Lucken sind Tore, durch die man überlichtschnell und doch vier Jahre Lebenszeit verlierend zum Merkur zurückkehren kann, der in der Parallelhandlung "untersucht" wird. Diese Hinterlassenschaften einer außerirdischen Zivilisation, welche den Menschen technologisch unendlich überlegen erscheint, wirken kontraproduktiv und haben die Isolation der Zwangssiedler nicht nur auf, sie fügen dem ersten Plot nicht viele Informationen hinzu. Um diese "Lücke" wieder zu schließen, verläuft die weitere Handlung fast schematisch. Die Aussiedler fühlen sich auf der Erde nicht wohl, auf ihrer Welt werden sie durch den energielosen Transport weiterer förmlich herausgeworfener Menschen an den Rand gedrängt und die Idee einer Generationenschuld wird zu wenig ausgearbeitet. Alle relevante Themen, die einen eigenen Roman verdient haben. Es spricht für Baxter, das er sie in die laufende Handlung unglaublich gut einbaut und den Lesefluss nicht unterbricht. Er setzt neue Akzente und löst die grundsätzliche Idee der Besiedelung einer fremden Welt, die Frontieridee nicht gänzlich ab, aber drängt sie zumindest an den Rand. Erst am Ende kommt er in einem Zeitraffer auf diese Prämisse zurück und zeigt vielleicht absichtlich auch ironisch das Aufkommen der Bürokratie in einer den Windeln entwachsenen Zivilisation.
Aber Baxter ist wie mehrfach angedeutet kein klassischer Erzähl SF Autor, sondern eine Ideenfabrik. Er geht selten einfache Wege und wer von der ersten Hälfte des Buches wie bei seiner "Zeitteppich" Serie überrascht worden ist, wird im Mittelteil eines Besseren belehrt. Auch wenn es der Autor nicht immer transportieren kann, geht es ihm um die Schaffung und an Hand der Menschheit auch um die leichtfertige Vernichtung von Leben. Es klingt nihilistisch optimistisch, wenn die Aussiedler nach der Vernichtung eines intelligenten Lebens im Sonnensystem davon sprechen, dass die Natur wieder einen Weg finden wird. In der schon angesprochenen, auf dem Merkur spielenden Nebenhandlung wird künstliches, aber nicht immer werthaltiges Leben erschaffen. Auf der fremden Welt sollen sich die Zwangsaussiedler den Planeten nicht nur Untertan machen, sondern wie die urwüchsige Natur fruchtbar sein und sich mehren. Darüber hinaus gibt es flüchtige Hinweise auf die Erbauer, die ihre Tore bestimmt nicht als Transportmittel der Menschheit hinterlassen haben. Auch Auswüchse der Natur. Aber Baxter schafft es in diesem Fall nicht zufriedenstellend, die ganzen Ideen zu einer kompakten Geschichte zu verbinden. Viele Flanken bleiben offen und wenn die nebensächlichen Episoden das Interesse der Leser länger halten als die Hauptgeschichte, dann zeigen sich die Schwächen am meisten.
Originaltitel: Proxima
Originalverlag: Gollancz
Aus dem Englischen von Peter Robert
Deutsche Erstausgabe, Heyne Taschenbuch
Taschenbuch, Broschur, 672 Seiten, 11,8 x 18,7 cm
ISBN: 978-3-453-31579-2
