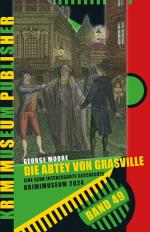Als 49. Band seiner Krimimuseumpublkationen präsentiert Mirko Schädel mit „The Abtey von Grasville“ einen Ende des 18. Jahrhunderts populären Schauerroman, der sich schon mehr zum Krimi wandelt und sogar aktiv eine junge Frau in Teile der Gegenwartshandlung agieren lässt.
Der Autor George Moore gehört zum Umfeld der damals sehr populären Ann Radcliffe. Anscheinend wurde das Buch ihr bei der anonymen Erstveröffentlichung sogar zugeschrieben. Der deutsche Verleger und Übersetzer Polt hat dieses Gerücht in die Welt gesetzt. De von Polt stammenden Titel „Eine sehr interessante Geschichte“ hat Mirko Schädel übernommen. Das Titelbild ist eine moderne Wiedergabe der Innenseitengraphik der deutschen Erstausgabe. Bei der Neuauflage hat der Inhaber des Krimimuseums nur offensichtlich Rechtschreibfehler beseitigt. Die blumige Sprache und die alte Rechtschreibung sind erhalten geblieben.
Im Original „Grasville Abbey. A Romance” genannt, wurde die Geschichte in 47 Fortsetzungen zwischen 1793 und 1797 in der Damen Zeitschrift „Lady´s Magazine“ veröffentlicht. Die Gewaltszenen wurden selbst für die damalige Zeit minimiert, die Romantik und vor allem die lange Zeit unerfüllte Sehnsucht nach dem Mann der Träume maximiert. Mirko Schädel weist in seinem Nachwort darauf hin, dass in dem Buch sehr viel gefrühstückt wird. Nicht nur gefrühstückt, sondern auch relativ jung gestorben. Die Handlung wird nicht geradlinig erzählt, sondern besteht aus ineinander geflochtenen Zeugenaussagen, welche die Leser und Leserinnen entweder durch Fundstücke- von Briefen bis zu Berichten – oder mündlichen Erzählungen verfolgen können. Mit dieser Vorgehensweise nimmt George Moore erstaunlich viel Tempo aus einer Geschichte, die vom chronologisch frühesten Rückblick mehr als zwanzig Lebensjahre umfasst und das Schicksal einer ganzen Familie beschreibt. Im Verlauf der Handlung nimmt der Autor einzelne rote Fäden noch einmal auf und fasst sie von einem anderen Protagonisten erzählt noch einmal zusammen. In der kompakten Gesamtausgabe wirkt diese Vorgehensweise ein wenig ärgerlich, aber angesichts der Erstveröffentlichung der Geschichte über einen Zeitraum von vier Jahren auch notwendig, um den Überblick zu behalten. Immerhin muss George Moore mit der von einem falschen Gespenst heimgesuchten Grasville Abbey immer wieder an den Ort des ersten Verbrechens (und später einer Reihe von Folgetaten) zurückkehren.
Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Familie Maserini. Alfred Maserini und seine Schwester Sisara – die später treibende Kraft - haben gerade ihre Mutter verloren. Alfred dient als Offizier in Flandern, Mathilde hat sich um die Mutter gekümmert.
In ein örtliches Kloster sind die beiden Geschwister Clementine und Felicien abgeschoben worden. Die eine Schwester fühlt sich wohl im Kloster wohl, die Andere will fliehen. Alfred hat sich in Clementine verliebt und will ihr zur Flucht verhelfen. Dabei hinterlassen sie einen Toten. Clementines Schwester ist – auch nicht zum letzten Mal in diesem Buch – im richtigen Moment, allerdings am falschen Ort gestorben. So werden die Drei steckbrieflich gesucht.
Der Versuch, seine Identität nachzuweisen, scheitert am Haftbefehl. Der Vetter Graf Ollifant hat sich inzwischen den väterlichen Besitz unter den Nagel gerissen. Dazu gehört auch die verfluchte Grasville Abbey, in welcher Alfreds Vater vor einigen Jahren verschwunden und wahrscheinlich ums Leben gekommen ist.
Die ausführliche Exposition der Geschichte ist nicht unbedingt notwendig, um den Plot zu folgen. Aber sie unterstreicht die minutiöse Planung des Autoren; die Kunst, ein ganzes Familienschicksal mit seinen Irrungen und Wirrungen, getragen von dem sozialen Platz auf der Hierarchie und der verzweifelten Suche nach dem rechtmäßigen Erbe geprägt.
Jeder der Protagonisten trägt sein Geheimnis mit sich. Verschweigt selbst den Geschwistern teilweise aus Scham –Alfred ist spielsüchtig – oder teilweise aus Angst vor einem sozialen Abstieg die Wahrheit. Einige dieser Informationen erhält der Leser durch die angesprochenen Aufzeichnungen und Berichte. Er hat also einen bedingten Wissensvorsprung einzelnen Figuren gegenüber. Ihm fehlt aber - wie alle Protagonisten - der Überblick.
Der Überbau der Geschichte ist gewaltig. Literarisch- kritisch wäre die Erzählung in dieser Form nicht möglich, wenn sich an einigen Stellen Männer und Frauen einfach miteinander unterhalten hätten. Einzelne Sequenzen basieren entweder auf Missverständnissen oder tragischen Fehlinterpretationen. Da wird über die Flucht ins Kloster gesprochen, um der Welt zu entsagen, weil man den Geliebten lange Zeit nicht gesehen hat oder dieser seine Gefühle noch nicht ausdrücken konnte. Herzschmerz mit insgesamt drei Liebesgeschichten – Alfred als Mann auf der einen Seite mit der Frau, die er liebt und dann die beiden Frauen (Schwester und ein neu gewonnene Freundin) auf der anderen Seite. Das wirkt emotional teilweise ein wenig zu drastisch, zu sehr den Erwartungen der gehobenen Leserschaft entsprechend, aber folgt auch den Regeln des romantisch- verklärten Unterhaltungsgenres. In heutigen Frauen oder besser Liebesromanen geht es wahrscheinlich immer noch so zu.
Spannungstechnisch zieht sich ein doppelter roter Faden durch die Handlung. Einmal der Tod des Vaters in der Abbey. Seine Leiche ist nicht gefunden worden. Aber zumindest hat er einen letzten Willen hinterlassen. Der zweite Handlungsarm ist der Konflikt mit dem allgegenwärtigen Schurken Graf Ollifont, der die Schwächen seiner Mitmenschen und auch Verwandten gnadenlos ausnutzt. Alfreds Spielleidenschaft versucht er am Laufen zu halten. Konfrontiert mit seinen Verbrechen dreht er in einer atemberaubenden Szene das Szenario auf den Kopf. Hier hilft ihm ein Diener, der zu spät kommt und nur das finale, Alfred belastende Ende sieht. An einer anderen Stelle leitet der Graf eine Diebes Bandes an oder betrügt mit falschen Noten. Auch wenn Graf Ollifant durch die langen Reise Szenen immer wieder aus der laufenden Handlung verschwindet, ist er allgegenwärtig und reut erst am Ende der Geschichte.
Trotz des gemäßigten Tempos entwickelt sich die Handlung ausgesprochen spannend. Die Kreise um die Familie werden immer weiter. Sie reisen aus ihrer Heimat erst gen Süden, dann wieder mit geerbtem Geld nach London, um über Frankreich wieder zu der im Titel erwähnten Abbey zu gelangen, wo sie sich monatelang verstecken und damit zur Legende um ein Gespenst beitragen.
Immer wieder treten neue Figuren auf, von denen der Eremit als jahrzehntelanger Beobachter wahrscheinlich die spät erscheinende, aber interessanteste Figur ist. Seine Berichte schließen schließlich die Lücken und enthüllen die Schicksale von einigen Figuren. Allerdings gibt es keine handfesten Beweise. Das zieht sich als Manko lange Zeit durch die Geschichte und der Leser hat den Eindruck, als wenn man die kleinen Gauner bestraft und die großen Schurken laufen lassen muss. Es gibt aber noch einen anderen Richter. Gott, der den Bösen ein schlechtes Gewissen macht und sie schließlich teilweise auch dem Wahnsinn überantwortet. Natürlich reinigt er sein Gewissen gegenüber den Maserinis, allerdings nur mit ehrlich geerbtem Geld. Das wirkt moralisch ein wenig überzogen, aber dient als Basis für das mehrschichtige Happy End.
Wie schon angedeutet, muss der Leser sich der blumigen Sprache stellen. Auch der Rückgriff auf Rückblenden und Erzählungen ist ein Zeichen der Zeit. In Deutschland war der populärste Abenteuer oder Gruselroman zu dieser Zeit Schillers „Geisterseher“. Das unvollendete Fragment wurde erst Jahrhunderte später von Hanns Heinz Ewers abgeschlossen. Es gibt keine inhaltlichen Überschneidungen. Aber im Gegensatz zum geradlinig erzählenden und mit einem hohen Tempo vorauseilenden Schiller hat Ewers für die zweite Hälfte der Geschichte auf das Handwerkszeug zurückgegriffen, das George Moore in diesem Roman zum Überfluss präsentiert. Berichte von Augenzeugen, aufgefundene Schriftstücke und schließlich eine Verdichtung der anfänglich ausführlichen Handlung auf eine direkte Konfrontation, indirekt durch neu auftretende Figuren eingeleitet. Sollte diese Vorgehensweise zu dieser Zeit und in diesem Übergangsbuch vom Schauerroman zum Krimi – die Polizei spielt nur eine bedingte Rolle; sie muss ab und zu die üblichen Verdächtigen verhaften und bei adligem Geblüt auch schnell wieder freilassen – üblich sein, dann hat Ewers mit seiner Interpretation ganze Arbeit geleistet. Als Krimi überzeugt die Geschichte nur bedingt, dass es im Grunde nur einen charismatischen Verdächtigen geben kann und dessen Motive erstaunlich schnell auf dem Tisch liegen. Allerdings dauert es bis zum Ende der Geschichte, bis sich Schurke und indirekte Opfer wieder an dem abgelegenen und gespenstischen Ort wieder treffen. Hier fordert George Moore die Geduld seiner Leser ein wenig zu sehr heraus.
Aber als Schauerroman folgt die Geschichte dem fast dreißig Jahre vorher entstandenen „Das Schloss von Otranto“ aus der Feder des britischen Politikers und Schriftstellers Horace Walpole, wobei einige der implizierten Exzesse wie Vergewaltigung inklusive der entsprechenden Entführung der unwilligen jungen Frau sehr dezent abgehandelt werden. Wie Mirko Schädel richtig anmerkt, hat Horace Walpole das Subgenre des romantischen Schauerromans begründet. George Moore dagegen schob mit diesem und wahrscheinlich einem zweiten Roman diese literarische Gattung modernisiert in Richtung Kriminalgeschichte weiter. Dadurch liest sich „Die Abtey von Grasville“ sogar eleganter und farbenprächtiger als Walpoles von H.P. Lovecraft in seinem Essay wieder ans Tageslicht gezerrt „Das Schloss von Otranto". George Moore spielt auch mehr mit den Elementen des Schauerromans, wobei es in seinem Buch neben sehr vielen Frühstücken, ausgesprochen vielen Toten abseits der Haupthandlung auch immer wieder blitzt und donnert. Vor allem wenn die kleine Gruppe von Helden im Dunkeln durch die Gänge der seit vielen Jahren verlassenen Abtey schleichen. Gute, literarisch herausfordernde und die Geschichte des Krimis ergänzende Lektüre, liebevoll einer neuen Generation als Nachdruck präsentiert.