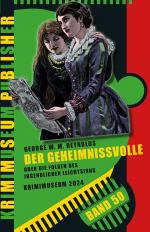Als kleiner Jubiläumsband 50 verlegt Mirko Schädel mit „Der Geheimnissvolle oder die Folgen des jugendlichen Leichtsinns“ – später auch als „Crawford, der junge Betrüger bekannt – den ersten umfangreichen Roman des lange Zeit auch in Frankreich lebenden George W.M. Reyolds. Schon früh ist in dieser Reihe der Doppelband „Der Leichenräuber“ aus dem Jahr 1845/ deutsche Ausgabe 1852 publiziert worden. Dabei hat sich Reynold von dem in Frankreich publizierten Fortsetzungsroman Eugene Sues „Die Geheimnisse von Paris“ teilweise mehr als inspirieren lassen. Aber auch der vorliegende Roman „Der Geheimnissvolle“ zeigt auf, dass Reynolds für die damalige Zeit rasant erzählen und vor allem rückblickend nicht einmal wirklich sehr komplexe Handlungen raffiniert aufbereiten und stellenweise durch wechselnde Perspektiven strecken kann. Reynolds erreicht zwar nicht die durchgehende Rasanz eines Sue oder eines Dumas, aber phasenweise wird der Leser förmlich in die Handlung eingezogen.
George William MacArthur Reynolds stammt aus einem soliden begüterten Elternhaus und gehört zu den populärsten Autoren der Unterhaltungsliteratur. Mit 16 Jahren ging er nach Frankreich, mit 20 Jahren gründete er zum ersten Mal eine Zeit und ging bankrott. Nach England zurückgekehrt nahm er die Idee der Feuilleton- Romane mit seinem Lieblingsschriftsteller Eugene Sue mit. Nach in Paris veröffentlichte er mit 21 Jahren den vorliegenden Erstling „The Youthful Impostor“. Drei Jahre später präsentierte die Ebner´sche Buchhandlung eine anonyme Übersetzung unter dem von Mirko Schädel übernommenen Titel in zwei Bänden. Angeblich soll es eine weitere Ausgabe mit dem Titel „Crawford, der junge Betrüger“ gegeben haben.
Zwölf Jahre nach der Erstveröffentlichung überarbeitete Reynolds den Text und präsentierte ihn unter dem Titel „The Parricide or the Youth´s Career of Crime“ noch einmal. Als „Die Glücksritter in London“ folgte eine anonyme Publikation in Wien 1855.
Reynolds schrieb noch eine Reihe von populären Unterhaltungsromanen mit zumindest Gruselbezügen, eingebunden meistens in Kriminalhandlungen.
Der Stoff wird durch einen übergeordneten, unzuverlässigen Erzähler zusammengehalten. Immer wieder zeigt dieser als mögliches Alter Egos Reynolds auf, dass es sich um eine Familiengeschichte handelt. Er greift mit einigen Anmerkungen der Zeit voraus; er unterbricht die fließende Handlung, um weitere Erläuterungen zu präsentieren, aber vor allem rafft er auch Abschnitte, in dem er auf vergleichbare Situationen an anderen Stelle der Geschichte verweist oder nach beginnenden Dialogen den Rest einfach zusammenfasst. Diese Mischung aus objektiver Geschichte und subjektiver Informationsbeschaffung des Lesers wirkt stellenweise ein wenig desorientierend und zieht den Leser förmlich aus der Handlung heraus. Ohne dieses im Verlaufe des Plots mehr und mehr eingesetzte Struktur- und weniger Stilmittel wäre die Geschichte wahrscheinlich noch länger geworden. Dabei hat Reynolds schon Schwierigkeiten, den anscheinend erwarteten Umfang zu erreichen.
Gegen Ende wirkt der Roman nicht richtig ausbalanciert. Den langen Erzählungen der im Gefängnis – aber nur in der oberen Etage – hausenden, noch über Mittel verfügenden Betrügern steht ein Finale gegenüber, das sich innerhalb von drei Seiten mit drei Toten entlädt. Spannungstechnisch nicht unbedingt die beste Vorgehensweise, zumal Reynolds in einem Punkt auf ein vom Leser erhofftes Happy End für die Familie Crawford verzichtet und mit dem für eine sympathische Figur nihilistischen Ende im Regen stehen lässt. Aber bis zu diesem Finale Furioso mit einem angedachten Doppelduell – Duelle spielen in der Geschichte eine wiederkehrende Rolle – vergeht sehr viel Zeit.
Diese Technik wird Robert Kraft teilweise ergänzt durch Tagebuchaufzeichnungen – einige seiner umfangreichen Kolportageromane sind im Grunde nur Tagebuchaufzeichnungen verschiedener Personen, literarisch umgewandelt – auch anwenden. Wie Reynolds greift er der Handlung vor, fügt Informationen hinzu, beginnt umfangreich zu erläutern oder fasst einzelne Szenen von oben einfach zusammen, um der Geschichte ein höheres Tempo zu verleihen. Robert Kraft und Reynolds haben noch eine weitere Übereinstimmung. Je komplexer, teilweise komplizierter ihre Erzählungen werden, desto mehr sehnen sie sich buchstäblich nach einem Ende und präsentieren die jeweiligen Finale ein wenig zu abrupt, zu hektisch.
Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Familie Crawford. Mirko Schädels Zusammenfassung verrät unwissentlich ein wichtiges Element. Vor einigen Jahren ist das Familienoberhaupt nach London gereist, um von einem „Verwandten“ Geld zu erbitten. Die Familie hat seit vielen Jahren immer am Rand der Existenznot gelebt. Er ist von dieser Reise nicht zurückgekehrt.
Misstress Crawford lebt mit ihren zwei Töchtern und einem Sohn in banger Erwartung und wirtschaftlich stetig steigender Not. Der Freund der Familie Arnold bietet Hilfe an. Zusammen mit dem einzigen Sohn will er sich auf die Suche machen. In Wirklichkeit beginnend mit einem nächtlichen Überfall erst auf einen allein reisenden Mann, später einen Offizier beginnt Arnold den Jungen zu einem Verbrecher zu machen. Wie sich später herausstellt, scheint in London zusätzlich eine Betrugswelle zu herrschen. Dabei geht es nicht nur um Adlige, die inzwischen arm wie Kirchenmäuse sind und sich mit Wechselverbindlichkeiten über Wasser halten. Zechprellerei in unterschiedlichster Form ist Gang und Gäbe. Aber Arnold hat zusammen mit dem jungen Crawford als williges Opfer ganz andere Pläne.
Sie inszenieren einen waghalsigen Plan. Sie heuern einen Kleinkriminellen an. Sie erfinden die Legende, dass es sich um einen der reichsten Männer Europas handelt, der sein Geld bei vielen wichtigen Regierungen (natürlich außerhalb von England) gelagert hat. Der junge Crawford hat diesen unglaublich reichen Mann aus einem brennenden Haus gezogen und sein Leben gerettet. Dafür will er ihn adoptieren.
Kaum hat sich die Legende verbreitet, beginnen die Londoner Kaufleute sich wie die Motten um das Licht zu sammeln und präsentieren auf Rechnung ihre Waren. Um das Geld fließen zu lassen, leiht sich Crawford als potentieller Sohn von einem jüdischen Wucherer namens Nathaniel immer wieder Mittel.
Arnold wohnt angeblich abseits der beiden Betrüger in einem eigenen Haus und geht Geschäften nach. Heimlich reist er aber wieder zu den Crawfords und verführt die jüngere Schwester mit Heiratsabsichten. Als Freund der Familie fällt es ihm in dieser Hinsicht leicht. Natürlich wird sie schwanger und Arnold will nichts mehr von ihr wissen.
Auch die ältere Schwester lernt einen schneidigen Offizier kennen, der sie nicht standesgemäß unbedingt heiraten möchte. Allerdings gibt es eine Verbindung zwischen dem Offizier und dem jungen Crawford. Und diese ist für den jungen Mann nicht positiv.
Dieses Ausgangsszenario entwickelt Reynolds im ersten Drittel des Romans. Vorgeschichten werden immer nebenbei erzählt. Der Leser wird an der Seite des ein wenig manipulativen Erzählers mitten in das Geschehen geworfen. Aus heutiger Zeit muss er sich nicht nur mit den zahlreichen Charakteren identifizieren, sondern auch die verschiedenen Sitten/ Gebräuche kennenlernen. Pragmatisch ließe sich sagen, wenn die Charaktere weniger miteinander schreiben würden, sondern eher von Angesicht zu Angesichts sich aussprechen, gäbe es diese umfangreiche Geschichte nicht. Aber die Irrungen und Wirrungen, das emotionale Verletzen und das spätere Verzeihen gehören zu dieser Art von Geschichten.
Betrachtet man die einzelnen Titel der beiden Ausgaben, dann haben sie alle ihre Daseinsberechtigung. Der Bezug auf den jugendlichen Leichtsinn trifft auf zwei der Crawford Kinder zu. Die Verführung und Schwängerung der jüngsten Schwester durch Arnold ist vielleicht dabei noch unter dem Begriff der sexuellen Naivität einzuordnen. Sie ist nicht die einzige Frau, die unverheiratet schwanger wird. Nicht in der Realität, nicht in dieser Geschichte.
Viel interessanter ist das Verhalten des jungen Crawfords. Sowohl jugendlicher Leichtsinn als auch der Alternativtitel „Crawford, der junge Betrüger“ wie auch der Titel der Neuauflage treffen zu. Warum Reynolds allerdings bei der Neuauflage ein wichtiges und lange verborgenes Element der Handlung gleich im Titel offenbart hat, bleibt rätselhaft.
Natürlich ist Crawford nicht nur ein klassischer Täter, sondern auch ein Opfer. Raffiniert manipuliert Arnold ihn von Beginn an. Die beiden Straßenüberfälle – einer der beiden Angriffe geht beinahe schief und sie werden als Täter gestellt – sind der Beginn der kriminellen Karriere, initiiert von Arnold und mit ausgeführt von Crawford. Interessant ist die Sinnhaftigkeit, denn Arnold stellt sich immer wieder als ein reicher Mann mit mehreren Häusern unter anderem in London dar. Ein solcher Mann als gewöhnlicher Straßendieb?
Viel interessanter ist der gigantische Betrug. Das Ziel ist es, möglichst viel Geld im Auge des fiktiven, im Ausland liegenden Vermögens zu ergaunern und sich dann nach Frankreich abzusetzen. Dabei hilft den Tätern auch die blinde Naivität und im Grunde Gier der Londoner Geschäftsleute, die sich förmlich dem unendlich reichen Mann und seinem potentiellen Erbe an den Hals werfen. Unaufgefordert werden Waren geliefert, geschäftliche Angebote gemacht und der nicht unbedingt ehrliche Nathaniel leiht gerne Geld zu Wucherkonditionen, die der junge Crawford ein wenig mildern konnte.
Niemand stellt sich die Frage, warum sich ein solch reicher und nach außen anscheinend unglaublich geiziger Mann überhaupt Geld zu diesen Konditionen leihen muss? Vor allem entspricht der exzentrische Lebensstil des Mannes nicht dem monetären Verhalten Crawfords. Ob diese Adoption überhaupt stattgefunden hat, wird genauso wenig geprüft, wie aus einer unglaublichen Geschichte – ein Hausangestellter will beobachtet haben, wie der reiche Exzentriker sein Geld auf dem Tisch im Hotel gezählt hat – eine Lawine wird. Immer phantastischer werden die meistens unter der Hand weiter getragenen Geschichten um seinen Reichtum. Als der Gönner sich dann über Nacht nach Schottland auf eine Geschäftsreise begibt, ist es Crawford, der das Hamsterrad am Laufen lassen muss und weiterhin Schulden macht.
Natürlich muss diese Pyramide irgendwann einbrechen. Es ist ein kleiner Zufall, das Etikett einer Weinflasche, die das Kartenhaus zusammenbrechen lässt. Aber auch hier ist wieder das schlechte Gewissen, der Faktor Zufall, welcher Crawford vor dem Ärgsten bewahrt.
Die Charakterisierung der männlichen Protagonisten im direkten Vergleich zu den weiblichen Figuren ist zeitgemäß. Reynolds arbeitet gerne mit Extremen. In einem derartigen Gaunerstück auch notwendig. Dabei durchlaufen seine männlichen Protagonisten eine Reihe von Entwicklungen. So wird aus einem eher kränklichen lokalen Arzt kurze Zeit der klassische Held, welcher die befleckte Ehre der Liebe seines Lebens wiederherstellen möchte, anstatt einfach mit ihr trotz eines unehelichen Kindes glücklich zu werden. Da ist der gleich zu Beginn nächstens überfallene Soldat aus adligem Haus, dessen Vater bis auf das Totenbett, aber nicht darüber hinaus hartherzig ist. Ein Jahr Frist räumt er seinem Sohn ein. Wenn er immer noch die junge Frau - sie ist natürlich nicht sein Stand - liebt und sie ihn, dann sollen sie mit seinem Segen heiraten. Dazwischen stellt sich der ältere Bruder, der dem narzisstischen Arnold in Nichts nachsteht. Aus dem Nichts heraus löst Reynolds die beiden familiären Probleme. Es ist nicht die erste oder letzte Glättung von innerfamiliären Problemen buchstäblich aus dem Nichts heraus. Die Auflösung der dramaturgisch guten Entwicklung zieht sich als Schwäche bis zum hektischen, fatalistischen, aber auch konsequenzen Ende durch die lange Geschichte.
Bei den Frauen ragt im Grunde nur die unter falschem Namen auf Guernsey lebende Ersatzmutter heraus. Sie nimmt sich der Schwangeren an. Sie hilft bei der Geburt und ist für Mutter/ Kind da. Sie hat eine eigene Meinung und sich von ihrem Mann emanzipiert. Alle anderen Crawford Frauen reagieren ausschließlich, fallen immer wieder in Ohnmacht oder stehen hilflos dem Schicksal gegenüber. Das wirkt wie ein Klischee, entspricht aber der damaligen öffentlichen Meinung.
Bis auf die weiblichen Mitglieder der Familie Crawford ohne den einzigen Sohn , einen jungen Offizier mit einem bösen älteren Bruder und einem hartherzigen Vater sowie einem an Liebeskummer erkrankten Arzt sind alle relevanten Figuren Reynolds Verbrecher oder Betrüger. Rückblickend ist es erstaunlich, dass kaum jemand wirklich so reich ist, wie er es vorgibt. Adelstitel sind Illusionen und wie zahlreiche im Gefängnis erzählte Geschichten zeigen, auch kein Schutzschild gegen die bösen Menschen, die tatsächlich irgendwann ihr Geld zurück haben wollen.
Die ganze Tragik der Geschichte Crawford basiert auch auf einem Missverständnis. Unabhängig vom Streit unter alten Freunden handelt es sich nur um Illusionen. Den Crawfords hätte nicht in dem Verhältnis geholfen werden können, das sie benötigen. Daher praktiziert Arnold eine perfekte Quadratur des Kreises, in dem er sich aus lange Zeit nicht erkennbaren Gründen plötzlich aktiv rächen will. Der Katalysator wird am Ende der Geschichte noch einmal beschrieben, aber das sich entwickelnde Momentum wirkt ein wenig konstruiert. Zu den besten Sequenzen gehört ohne Frage die Entlarvung des Geheimnissvollen beim Zusammentreffen fast aller Beteiligten in einem kleinen Haus auf der Insel Guernsey. Geschickt hat Reynolds lange Zeit nicht nur seine Protagonisten manipuliert, sondern mittels zweier Personen – die in Wirklichkeit eine Persönlichkeit sind – auch die Leser getäuscht und an der Nase herumführt. Dabei geht der Autor fair mit den Lesern um. Die Beziehungen zwischen Arnold und dem Geheimnissvollen sind in keiner dem Leser bekannten Konstruktion zu erkennen. Es ist ein Zufall, das überdrehende Momentum, das schließlich die Verhältnisse offenbart. Dazu benötigt es nicht nur den angesprochenen Zufall, sondern auch eine gewisse Arroganz auf der Seite des Geheimnissvollen, der eigentlich wissen müsste, wer in dem Haus unter einem anderen Namen wohnt. Schließlich hat Reynolds diese plottechnisch elementare Tatsache mehrmals erwähnt.
Mit überschwänglichen Emotionen zwischen himmelhochjauchzend und natürlich zu (selbstmordtechnisch) zu Tode betrübt findet sich das ganze Spektrum in diesem umfangreichen Roman. Der eloquente, an einigen Stellen auch aus heutiger Sicht übertriebene Schreibstil erfordert schon sehr viel Geduld vom Leser. Eugene Sue und Alexandre Dumas sind in dieser Hinsicht ein wenig leichter zu lesen. Reynolds setzt mehr auf die charakterliche Entwicklung oder den den jeweiligen Titel folgend auch Fehlentwicklungen der jeweiligen Figuren mit dem charismatischen, aber schließlich aus der Handlung verschwindenden Egozentriker Arnold als Initiator und dem jungen Crawford als willigen Opfer, das sich schnell an das betrügerische Leben gewöhnt. Beim Wucherer Nathaniel zeigt sich der Antisemitismus der Zeit. Reynolds ist das keine Ausnahme. So zeigt er auf, dass Nathaniel im Grunde auch nur durch Betrug wieder reich geworden ist. Ohne seine Karriere als ein weiterer Betrüger könnte er Crawford das Geld nicht leihen und wird selbst an den Rand des erneuten Bankrotts gebracht. Nathaniel ist eine seltsame Figur. Er ist ein Geschäftsmann, lässt sich aber trotz seines Misstrauens blenden, auch wenn er selbst nach vergleichbaren Methoden gegriffen hat. Angesichts des vollen Gefängnis mit ehrenwerten Betrügern ist es erstaunlich, wie naiv die Londoner Öffentlichkeit angeblich gegenüber einem weiteren sehr reichen Mann mit einem Liquiditätsproblem ist. Wie bereitwillig die Wirte Kredit für ihre Gäste geben. Auf der anderen Seite ist es verblüffend, wie gut die angeblich bankrotten Männer im Gefängnis - im oberirdischen Teil - leben und sich gegen Barzahlung bewirten lassen können. Anscheinend fließt immer noch gutes Geld schlechtem hinterher. Die Hoffnung, wenigstens einen Teil der Kredite auf diese Art irgendwie zurückzubekommen, stirbt zuletzt. Ein interessantes finanzielles Perpetuum Mobile, das damals wie heute seine kriminelle Berechtigung hat. Derartige Naivität muss bestraft werden.
Crawford ist Opfer und Täter zugleich. Ohne Frage wird er verführt und ist gleichzeitig auch der Verführer. Er unterliegt dem Geld, entfernt sich von seiner Familie. Das reuige Gewissen kommt relativ spät, als ihm in einer weiteren Konstruktion der Handlung eine rettende wie verräterische Hand gereicht wird. Crawford Aktionen und Reaktionen haben indirekte wie direkte Auswirkungen auf den Rest der Familie. Reynolds konzentriert sich zusätzlich auf die Scheinwelt, in welcher die Adligen berechtigt wie reich oder unberechtigt arm sich an die eigenen Titel klammernd, leben. Die Themen Titel und Erbe ziehen sich mehrfach als rote Fäden durch die Handlung und nicht selten wird erst auf dem Totenbett vergeben. Das wirkt aus heutiger Sicht theatralisch und kitschig, kam aber bei den Lesern gut an.
“Der Geheimnissvolle oder die Folgen des jugendlichen Leichtsinns” sind reine Kolportage, wie sie vor allem Karl May in den fünf umstrittenen Fortsetzungsgeschichten oder Robert Kraft mit Hinzufügung utopischer Ideen schreiben sollten. Tragische Familiengeschichten voller kitschigem Herzschmerz und herzzerreißender Rettung. Nur hat Reynolds die fast sadistische Neigung, alles auf eine Spitze zu treiben und dann unromantisch enden zu lassen. Aber wer sich auf diese Art von literarischer Unterhaltung einlässt, wird trotz des Umfangs von mehr als siebenhundert Seiten gute zweihundert Jahre in die Vergangenheit transportiert und gut unterhalten.