Frank M. Robinson hat sich in seiner langen Karriere in verschiedenen Genres getummelt. Einige seiner wichtigsten Bücher, teilweise in Kooperationen entstanden, sind von Hollywood verfilmt worden.
„The Power“ ist sein ebenfalls von George Pal verfilmter Abstecher in die Science Fiction gewesen, in den siebziger Jahren diente einer seiner Romane als eine von zwei Vorlagen für den Katastrophenfilm „The Towering Infero“.
Anfang der neunziger Jahre wandte sich der Sammler von Pulp Magazinen wieder der Science Fiction zu und präsentierte mit im Original „The Dark Beyond the Stars“ eine umfangreiche Space Opera, die von vielen kleinen und originellen Ideen sowie einer stringenten, an den fliegenden Holländer in Kombination mit Ahabs Obsession mit seinem weißen Wal geprägt ist.
Die grundlegende Idee ist nicht neu. Ein Raumschiff der Erde dringt immer tiefer ins All ein, um außerirdisches Leben und bewohnbare Planeten zu finden. Im Gegensatz allerdings zu „Enterprise“ auf ihrer 5 Jahres Mission droht die Technik des Raumschiffs mehr und mehr zu versagen, der Kapitän will das Dunkel zwischen zwei Galaxien als eine Reise ohne Wiederkehr überwinden und die Menschen finden kein Leben, keinen bewohnbaren Planeten.
Grundsätzlich dient das ominöse „Dunkel“ eben zwischen den Sternen als eine Art Wendepunkt der Reise. Die Mannschaft hat im Gegensatz zu langlebigen Kapitän Angst davor, den zumindest irgendwo griffigen Raum mit Sternen um das Raumschiff herum zu verlassen und buchstäblich ins Unbekannte aufzubrechen. Da helfen auch keine perfiden Tricks des Kapitäns, der mit seiner paranoiden Art und Weise tatsächlich an eine Art Ahab ohne Holzbein auf der Suche nach seinem metaphorischen weißen Wal ähnelt. Nur ist dieser eben die fixe Idee, außerirdisches Leben zu finden. Der Mann kann und darf nicht alleine im All sein. Astronomisch betrachtet man Robinsons „Bild“ keine Sinn, den die Erde liegt ja eben am Rande der Milchstraße und nicht im Zentrum. Entgegen der ursprünglichen Mission hat sich das Raumschiff als eher dem Zentrum angenähert, um eine größere Anzahl von möglichen Sonnen und damit entsprechenden Planeten zur Auswahl zu haben. In Robinsons Buch fliegen sie im Grunde verkehrt, daher wirkt diese Angst genauso aufgesetzt wie eine Reihe von falschen Spuren, die der Autor mit fast sadistischer Freude beginnend von der ersten Sequenz an verfolgt.
Frank M. Robinson ist sich seiner Vorgänger beginnend bei Poul Anderson und Robert A. Heinlein, sowie hinsichtlich der Degeneration der Besatzung aus Aldiss „Non Stop“ sehr wohl bewusst. Er folgt nicht Gene Wolfes Meisterwerken um die lange Sonne. Aus Fernsehserien wie „Star Trek“ hat der Autor Ideen wie das Holodeck entnommen und sie entsprechend verfeinert.
Der Roman ist aus der Ich- Perspektive erzählt worden. Der siebzehnjährige Sparrow wird bei einem Unfall auf einem der wenigen entdeckten, aber unbewohnbaren Planeten verletzt. Sparrow wird auf der Krankenstation gut behandelt, aber niemand will sich wirklich mit ihm unterhalten. Es ist auf der einen Seite eine fast klassische Ausgangsbasis, die auf der anderen Seite wie fast alles in dem Buch plötzlich nicht nur in Frage, sondern auf den Kopf gestellt wird.
Im Folgenden greift Frank M. Robinson auf eine Reihe von fast fragmentarisch zu nennenden Szenarien zurück, die sich aber gegen Ende des Romans miteinanderverbinden.
Dreh- und Angelpunkt sind auf der einen Seite Sparrow und auf der anderen Seite der Kapitän. Ohne zu viel von den überraschenden Elementen der Handlung zu verraten sind sie zwar zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, aber es verbindet sie viel mehr, als sie es ahnen. Frank M. Robinson nimmt sie als Spiegelbild von zwei Strömungen. Autorität bis zur Unterdrückung der ihm anvertrauten Besatzung durch den Kapitän unter Vorspiegelung dieser verantwortungsbewussten, aber im Grunde auch absurden Mission. Dagegen steht in mehrfacher Hinsicht Humanität. Wie eine Zwiebel entblättert der Autor mögliche Ideen. Diese machen nicht immer rückblickend einen Sinn, aber mit jeder Wendung der Handlung wird der Leser zusammen mit vor allem Sparrow überrascht.
Die Konflikte zwischen Sparrow und einigen Besatzungsmitgliedern, aber schließlich auch Sparrow und dem Kapitän verschärfen sich, je näher das Raumschiff dem Dunkel kommt. Eindrucksvoll sind vor allem auch die Landungen auf den beiden unwirtlich schönen wie auch tödlichen Welten.
Die beiden Landungen sind aber nur ein verzweifelter Versuch, endlich fremdes Leben in welcher Form auch immer zu finden, um nach Hause zurückzukehren. Jede gescheiterte Ladung verstärkt die depressive Stimmung. Frank M. Robinson agiert in diesem Epos sehr viel effektiver und vor allem auch nuancierter als in seinen mehr vom Plot und weniger den Charakteren getriebenen früheren Arbeiten. Das Raumschiff mit seinem stetigen Verfall erinnert ein wenig an Peakes „Ghormenghast“ Schloss, in dem die lebenden „Toten“ hausen müssen. Für immer wie der legendäre fliegende Holländer an Bord seines / ihres Raumschiffes im Meer der Sterne gefangen. Der Eindruck verstärkt sich im abschließenden dritten Teil. Die Besatzung muss für ihr Traumziel auf jeglichen Luxus, jegliche Illusion verzichten.
Auch wenn sich der Plot fatalistisch entwickelt und der Leser sich fragt, warum ausgerechnet in diesen Momenten die Mannschaft derartig reagiert, denkt Frank M. Robinson seine Idee des unfreiwilligen Generationenraumschiffs genau konsequent zu Ende wie es Poul Anderson in seinem Meisterwerk „Universum ohne Ende“ getan hat. Nur schenkt Robinson seinen Protagonisten bis zum zynischen, ein wenig abrupten Epilog einen Schimmer Hoffnung.
Frank M. Robinson nimmt wie eingangs erwähnt den Staffelstab seiner Kollegen Anderson oder auch Aldiss auf. Wie Jahre später Kim Stanley Robinson aber in „Aurora“ beschreibt er nicht nur ein perfektioniertes, aber angesichts der Dauer der Reise nicht mehr perfektes System, das wirklich alles recycelt. Er geht auf das Freizeitverhalten der Menschen inklusiv homosexueller Partnerschaften sowie Zuchtehen ein, in denen sich die Frauen von mehreren Männern beginnend mit dem Kapitän begatten lassen. Theateraufführungen sowohl klassischer Literatur als auch fiktiver Dramen sollen die Langeweile bekämpfen, wobei die Aufgaben der Besatzung zwischen den Landungen eher ambivalent als nachvollziehbar beschrieben werden. Dabei strapaziert Frank M. Robinson manchmal bei seinen existentiell philosophischen Exkursen in einem fatalistischen Schreibstil auch die Grenzen der Geduld seiner Leser.
Frank M. Robinson packt viele Ideen in den Plot. Immer wieder sind es kleine Szenen, die sich anders entwickeln. Das beginnt und endet im Grunde mit Sparrow, einer tragischen Figur, deren originäre Mission in einem Widerspruch zum Auftrag des Kapitäns steht. Diese Szene zeigt das Dilemma, in dem sich viele seiner brüchigen fragilen Protagonisten befinden. Das aus einer anscheinend sorgfältig geplanten Mission inklusiv eines Rückkehrpunktes Chaos erwächst, wird konsequent und überzeugend entwickelt. Auch wenn einzelne Sequenzen aus anderen Büchern vertraut wirken, hat Frank M. Robinson etwas gänzlich Eigenständiges entwickelt. Die Verunsicherung der Protagonisten überträgt sich gut auf die Leser, da sie bis auf die fast verzweifelt erscheinende mehr und mehr fatalistische Mission im Grunde keine Zukunft für sich selbst. Aber auch ihre jeweilige Vergangenheit steht zwischen den Sternen. Die Geschichte des Schiffes beginnend mit dem Start – dieser bildet quasi das Ende des Buches – über eine Meuterei vor vielen Generationen und endet schließlich mit der überfälligen Konfrontation zwischen den beiden Interessengruppen.
Durch seine Vorgehensweise verschleiert Frank M. Robinson aber auch eine Reihe von Entwicklungen. Wie bei einer Zwiebel wird jede Schale vor allem im letzten Abschnitt des Buches dank Sparrows kontinuierlichen Recherchen, aber auch seine besonderen Position innerhalb der Mannschaft abgeschält, seziert, begutachtet und schließlich teilweise zu Gunsten einer anderen Variation verworfen. Das macht die Lektüre so interessant, vor allem weil sich Frank M. Robinson mit seiner im Grunde fast obsessiven Suche nach intelligentem Leben zwischen den klassischen Generationenraumschiffromanen und eben Poul Andersons subtil den doch begrenzten technischen Fortschritt in Kombination mit dem Faktor Mensch analysierenden Werken hin und her bewegt.
Die Charaktere sind interessant und vielschichtig beschrieben worden. Nicht selten nutzt der Autor aber die Möglichkeit, an Hand von Chiffren einzelne Positionen zu entwickeln. Für den Fortbestand der Besatzung hat er sich ein im Grunde frauenfeindliches Fortpflanzungssystem, das der Autor ein wenig relativiert. Auf der anderen Seite handelt es sich um eine bisexuelle Gesellschaft, in welcher die Geschlechter weniger eine Rolle spielen als die Idee, befreiten Sex egal mit wem zu haben. In der zweiten Stufe gibt es zwar Partnerschaften, die eheähnlichen Regeln unterliegen, aber das Recht auf die erste Nacht wird ambivalent vom Kapitän auf die ganze Mannschaft übertragen.
Wenig erkennbar für den Leser ist, wie viele Besatzungsmitglieder noch an Bord des Schiffes sind. Anscheinend ist auf der einen Seite jeder Rohstoff wichtig und die Körper der Toten werden recycelt. Auf der anderen Seite gibt es – wie das Ende zeigt und es dem Kapitän bewusst ist – auch noch Resourcen in anderen Teilen des Raumschiffes. Manchmal leben die Menschen in engen Gängen, dann gibt es ganze Bereiche im Schiffe, die absichtlich nicht genutzt werden. Das wirkt teilweise improvisiert.
Das Tempo des Romans ist von Beginn auch durch die verschiedenen Unsicherheiten erstaunlich hoch angesichts des Umfangs. Frank M. Robinson ist ein auch durch die Mitarbeit an Filmen vorbelastet, so dass er immer wieder kleine Höhepunkt setzt, die wie mehrfach erwähnt einiges in Fragen stellen, aber auch andere Varianten anbieten. In vielen Punkten überrascht „Das Dunkel jenseits der Sterne“ durch eine originelle Nutzung bekannter Versatzstücke des Genres in Kombination mit einem in mehrfacher Hinsicht ambivalenten Protagonisten, der erkennen muss, dass weder die Mission noch der Ausgangslage entspricht oder sein eigenes Leben auf recherchierbaren Fakten basiert.
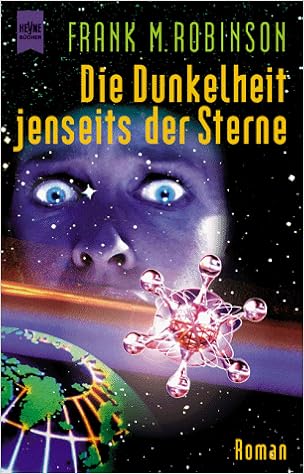
- Broschiert: 541 Seiten
- Verlag: Heyne (1999)
- Sprache: Deutsch
- ISBN-10: 3453140133
- ISBN-13: 978-3453140134
