Als Herausgeberin ist Kate Wilhelm für die bis dahin schon neunte Anthologie mit den besten, durch den Nebula Award ausgezeichneten Kurzgeschichten bis zur Novelle verantwortlich. Ihr Mann Damon Knight kommentiert in seinem kurzen Artikel die hier nicht vorgestellten Preisträger aus den Kategorien wie Roman oder bester Film. In ihrem Vorwort macht Kate Wilhelm deutlich, dass die Science Fiction lebt. Sie wird gelesen und vor allem auch von einer jüngeren Generation gelebt, wie die Einschreibungen zu verschiedenen Kursen an den Universitäten zeigen. Die Auguren haben unrecht. Vieles aus ihrer Feder lässt sich auf die Gegenwart übertragen. Carol Eshwiler fügt Kate Wilhelms Gedanken in der diese Sammlung abschließenden Miniatur literarisch auch noch einen weiteren Aspekt hinzu. Die Neugierde, welche den Menschen von klein auf antreibt.
Ben Bova schreibt über die Bedeutung dreier griechischer Götternamen hinsichtlich der inzwischen mit ihnen verbundenen Projekte. Zwei haben direkt mit der Raumfahrt zu tun, einmal dreht es sich um Langlebigkeit.
1973 war ein starkes Jahr vor allem für die kürzeren Texte. Kraftvoll, experimentell, provozierend. Gene Wolfe macht das schon mit der Auftaktgeschichte „The Death of Doctor Island“ deutlich. Nicholas Kenneth de Vore wacht auf dem Strand einer einsamen Insel auf. Eine Stimme, die sich selbst Dr. Island nennt, flüstert ihm kontinuierlich eher Floskeln ins Ohr. Er wird von einem jungen Mann namens Ignacio zusammengeschlagen, er findet eine verstörte Frau namens Diane, die an irgendwelchen Männern Rache üben möchte. Die Flora und Fauna haben der Insel ergeben nachhaltig keinen Sinn, auch wenn de Vore seine Umgebung als real anerkennt.
Gene Wolfes Text ist eine verstörende Parabel, die das soziale Verhalten der Menschen auch sich selbst gegenüber untersucht. Es ist kein „Herr der Fliegen“ Szenario; es ist keine Analyse einer Sinnkrise, sondern der Versuch, eine Art bizarre Coming of Age Geschichte zu erzählen, in welcher der Protagonist im Grunde seinen eigenen, durch die Insel noch stark eingeschränkten Weg zur Selbstbestimmung, zur Definition einer eigenen Persönlichkeit finden muss.
Aus heutiger Sicht fügt sich noch die Idee hinzu, das nichts wirklich real ist. Dr. Island könnte Gott sein, aber auch die Stimme einer künstlichen Intelligenz, die in einer künstlichen Umgebung über die letzten Menschen wacht. Das offene Ende lässt sich in verschiedene Richtungen interpretieren. Die Figuren, denen de Vore begegnet, sind im Grunde klischeehaft. Ignacio ist rohe Gewalt. Theoretisch vielleicht die Vater, der mit der nächsten Generation nichts anfangen kann. Die verstörte Diane als Mutterfigur erscheint dagegen deutlich eindimensionaler, klischeehafter und vor allem weniger zugänglich. Die Dialoge erscheinen gestelzt, absichtlich künstlich. Sie erklärt ihm die „Welt“, wie sie diese versteht. Dr. Island als allgegenwärtige, aber auch manipulierende Präsenz macht sein/ihr Interesse weniger deutlich. Er warnt und mahnt, aber er hilft auch nicht aktiv.
Sprachlich komplex und intensiv voller freudscher Symbole und jungscher Andeutungen ist „The Death of Doctor Island“ eine herausfordernde, aus Puzzleteilen bestehende Novelle, die immer wieder unterschiedlich zusammengesetzt werden kann. Darin liegt ihr Reiz, aber auch vielleicht das Verhängnis, für die „normalen“ Leser zu intellektuell clever konzipiert und zu wenig emotional entwickelt worden zu sein.
Vonda McInytres "Of Mist, and Grass and Sand." gewann den Nebula 1973 als beste Novellete. Zwei Jahre später hatte die Amerikanerin die Geschichte zu dem im Knaur Verlag auf deutsch veröffentlichten Roman “Die Traumschlange” erweitert. Vonda McInytre gwann für die Romanversion ebenfalls den Nebula, zusätzlich noch den HUGO als bester Roman des Jahres.
Es ist die einfache Geschichte einer Frau, einer Heilerin in einer postapokalyptischen Welt. Sie soll einem Jungen mit Krebs helfen. Dessen am Rand der Wüste lebende Familie hat Angst vor der aus ihrer Sicht Hexe und ihren Schlangen. Dabei ist das Schlangengift die Medizin der Zukunft. Die einzige Medizin.
Wie Ursula LeGuin schreibt Vonda McIntyre über die fast stoische Entschlossenheit einer Frau, anderen Menschen zu helfen, auch wenn sie persönlich abgelehnt wird. Sie ist selbst bereit weiterhin zu helfen, als eine ihrer wichtigsten Schlangen getötet wird. Sie sucht die Schuld bei sich.
Der Charme der Geschichte liegt in der Nutzung alter Medizintechniken. Die Zeichnung aller Figuren mit ihren wenigen Stärken und Schwächen ist ausgesprochen dreidimensional. Der Leser leidet vor allem mit der jungen namenlosen Heilerin, wenn sie eine ihrer Schlangen verliert. Ihre Erschöpfung, aber auch ihr Dickkopf, durchzuhalten, ist spürbar. Der Hintergrund wird auf das Rudimentärste reduziert, die Figuren sind wichtig. Die Autorin zeigt auf, welche Opfer einfache Menschen auf sich nehmen, um zu helfen. Auch wenn es ihnen nur spärlich gedankt wird. Anrührend, emotional bis an die Grenze zum Kitsch, aber keinen Schritt weiter handelt es sich um eine zeitlose, deutlich kraftvollere Version als der später veröffentlichte, ohne Frage auch lesenswerte, aber nicht so fokussierte Roman “Die Traumschlange”.
Unter den nominierten Story hat Kate Wilhelm Harlan Ellisons “The Deathbird” ausgesucht. Der Amerikaner hat für diesen Text zumindest den HUGO Award erhalten. In seinem markanten expressiven Stil vermischt der Autor klassische Science Fiction Elemente wie das Erwecken des Protagonisten Nathan Stark durch Aliens mit den Legenden und Mythen der Alten Erde. Nicht umsonst zieht sich der Plot von ihrem Beginn 25000 Jahre in der fernen Zukunft bis zu ihrem Ende und damit dem Beginn der Erde durch viele Epochen. Immer gegen das Empfinden der Leser. Gott ist bei Harlan Ellison verrückt, Satan behütet auf seine Art die Menschen. Am Ende ist es zu Beginn in der fernen Zukunft ausgerechnet der Schläfer, der das Schicksal der Welt auf seinen Schultern trägt.
Die Handlung wird durch klassische Schultests unterbrochen. An einigen Stellen präsentiert Harlan Ellison nur die Aufgaben, in anderen Passagen nur Auflösungen. Der Plot springt hin und her. Die Dialoge bestehen aus gewichtigen Worten im metaphorischen Sinne. Alles ist überdimensional.
Auch wenn es um das Schicksal einer Welt, vielleicht der Welt geht, konzentriert sich bis zum fatalistischen, aber auch konsequenten Ende der Autor auf klassische Motive wie Haß und Liebe, Einsamkeit und Gemeinschaft. Herausfordernd, experimentell, provozierend und einzigartig Ellison.
Bei den Kurzgeschichten gewann James Tiptree jr. für “Love Is the Plan the Plan Is Death”. Drei ihrer vier Mitkonkurrenten sind ebenfalls in dieser Anthologie abgedruckt worden. Nur die Kurzgeschichte von Vonda McIntyre fehlt. Die Autorin ist allerdings mit ihrer ebenfalls ausgezeichneten Novellette vertreten.
Ausschließlich aus der Perspektive einer fremden Spezis erzählt erhält der Leser einen Einblick in den Imperativ der Biologie, dem sich intelligente Wesen - dabei steht die an eine Spinne erinnernde Kreatur Moggadeet auch für den Menschen und seine Evolution - am Ende erfolglos zu widersetzen suchen. Der Plan aus dem Titel ist der Lebenszyklus auf einer unwirtlichen Welt. Während des Winters verlieren die Kreaturen einen Teil ihrer Intelligenz, wobei James Tiptree jr. keine weiteren Erklärungen nachschiebt. Moggadeet versucht sich in dieser Periode seine Intelligenz zu erhalten, was immer schwieriger wird. Am Ende ist Moggadeet auch nur ein Teil des Plans, der das Überleben des Lebens per se garantiert, aber auf individuelle Schicksale keine Rücksicht nimmt.
Wie in einigen anderen ihrer herausragenden Geschichten setzt sich James Tiptree jr. mit evolutionären Themen auseinander, welche die “Grenzen” der einzelnen Rassen bzw. Tierarten überschreiten. Ihre Stories sind eher fatalistisch bis nihilistisch, Happy Ends gibt es in ihren Texten so gut wie gar nicht. Ausschließlich wie erwähnt aus der fremden Perspektive erzählt gelingt es der Autorin, eine Nähe zwischen Lesern und Moggadeet in seinem fast aussichtslosen Kampf aufzubauen, mit dem er die eigene Intelligenz und damit ein besseres Überleben während der Winterzeit zu sichern sucht.
Der bekannteste Verlierergeschichte stammt aus der Feder George R.R. Martins: “With Morning comes Mistfall”. Der Titel ist gleichzeitig einer der markantesten Dialogzeilen dieser bittersüßen Geschichte um Legenden, Mythen und Monstren. Wraithworld ist ein kaum zu bewohnender Kolonialplanet mit zwei bekannten Facetten: ein permanenter Nebel überdeckt die Planetenoberfläche. Morgens senkt sich der Nebel an den Bergen herab und gewährt den Besuchern und wenigen Bewohnern einen Blick auf die wunderschöne Oberfläche dieser Welt. Angeblich wohnen in den Nebeln die “Wraiths”, mystische Kreaturen, welche Menschen verschleppen und töten. Eine wissenschaftliche Expedition soll das Phänomen untersuchen.
Die Geschichte wird aus der Perspektive eines Reporters erzählt, welcher die Expedition begleitet. Dank ihres Gastgebers lernt er nach und nach die unwirtliche Schönheit dieser Welt kennen,
John M. Ford hat die Reporter in “Der Mann, der Liberty Wallace erschossen hat” davon sprechen lassen, das sie weiterhin die Legenden drucken, wenn die Wahrheit ans Licht gekommen ist. George R.R. Martin sieht es anders. Das Ende der Geschichte ist pragmatisch und konsequent. Aber in Martins Welt gibt es keine Legenden mehr. Der Nebel hat sein Geheimnis preisgegeben. Die Charaktere sind dreidimensional gezeichnet. Die Story in dem für einige in dieser Anthologie versammelten Geschichten kennzeichnend melancholischen Stil erzählt, besticht durch die wunderschöne Atmosphäre dieser Welt und die erwachsene Auseinandersetzung mit den eigenen Träumen, Wünschen und vor allem auch Vorstellungen.
Norman Spinrads “A Thing of Beauty” ist dagegen eher ein Pointentext. Die USA haben nicht zuletzt dank eines Bürgerkriegs abgewirtschaftet. Japan ist die neue Antriebskraft der Wirtschaft. Die reichen Japaner kaufen die USA buchstäblich leer. Der Protagonist soll einem japanischen Milliardär in New York ein Bauwerk für dessen Garten zeigen, das abgebaut und in Japan wieder aufgerichtet werden kann. Norman Spinrad zeigt in dieser kleinen Groteske die kulturellen, aber auch die ideologischen Unterschiede zwischen dem Westen und dem Osten in Form des Landes der aufgehenden Sonne auf. Aus heutiger Sicht wirkt angesichts der konträr verlaufenden wirtschaftlichen Entwicklung Japans und den USA der Plot antiquiert. Kein Leser ist überrascht, auf welches Objekt sie sich schließlich nach der Ablehnung der zerstörten Freiheitsstatue, des örtlichen Baseball Stadions und den UN Gebäuden einigen.
Edward - später wurde daraus Ed - Bryant ist ein Name, der heute eher älteren Lesern etwas sagt. Er gehört neben George R.R. Martin, John Shirley, John Varley, Lucius Shepard zu einer neuen jungen Generation von Phantastikautoren - das SF Genre ließen sie bald hinter sich -, die andere Wege gingen. Die für den Nebula Award nominiert Kurzgeschichte “Shark” erschien in einer von Damon Knight herausgegeben “Orbit” Anthologie, einer wegweisenden Reihe von Kurzgeschichtensammlung. In Deutschland veröffentlichte der Fischer Verlag in der “Fischer Orbit” Reihe ein gutes Dutzend dieser Anthologien.
“Shark” ist eine klassische Antikriegsgeschichte. Der inzwischen seit vielen Jahren auf einer kleinen Insel lebende Ozeanograph hat sich von den militärischen Forschungen zurückgezogen, in denen in Tiere menschliche Gehirne eingesetzt werden sollten. Vor allem wollte das Militär die perfekten Killer - eben Haie - für ihre Experimente, aber auch Angriffskriege nutzen. Seine Freundin hat sich während des Krieges und der ersten Experimente als Testobjekt zur Verfügung gestellt, ihr Gehirn wurde in den Körper eines großen weißen Hais verpflanzt. Hier hat sich Bryant wahrscheinlich eine Inspiration bei der literarischen Vorlage zu Steven Spielbergs Film geholt. Der Film selbst ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht worden.
Jetzt will das Militär den Ozeanographen entweder zurückholen oder töten lassen, damit seine Forschungen nicht in falsche Hände geraten.
Die Geschichte zeichnet neben den gut überschaubaren Wechseln zwischen verschiedenen Handlungsebenen eine dreidimensionale Zeichnung der Protagonisten in Grautönen ohne die üblichen Klischees von Schurken und Helden aus. Im gleichen melancholischen Stil wie George R.R. Martins Story geschrieben handelt es sich bei “Sharks” um eine dunkle Abrechnung mit dem immer wieder aufflammenden Krieg und den rücksichtslosen Opportunisten.
Wie Kate Wilhelm in ihrem Vorwort schon sagte, das Genre ist auch Mitte der siebziger Jahre nicht tot. Die Experimente der New Wave haben sich relativiert, die Autorin haben diese literarische Welle aus Großbritannien kommend als Sprungbrett gesehen, um vor allem im Bereich kürzerer Texte weiter zu experimentieren. Dazwischen stehen die Romantiker wie George R.R. Martin, die stilistisch auf einem hohen Niveau einfache simple Liebesgeschichten erzählen. Diese neunte Sammlung präsentiert nicht nur eine bunte Mischung des Genres, vor allem sind alle Storys ausgesprochen lesenswert. Die Sammelbände ermöglichen es vor allem auch jüngeren Lesern, die Geschichte der literarischen Science Fiction zumindest per annum kennenzulernen. Und Altfans werden in Erinnerungen an das erste Mal schwelgen, als sie diese Texte vielleicht auch in den ursprünglichen Magazinen das erste Mal gelesen haben.
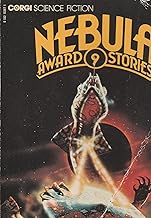
- Herausgeber : Corgi Childrens; New Edition (1. November 1976)
- Sprache : Englisch
- Taschenbuch : 285 Seiten
- ISBN-10 : 0552103071
- ISBN-13 : 978-0552103077
