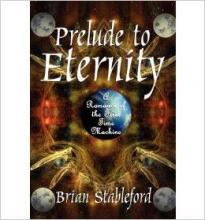
Brian Stablefords "Prelude to Eternity: A Romance of the First Time Machine" ist rückblickend eine intellektuell ansprechende Lektüre, die teilweise dem nicht mehr unbedingt originellen Genre der Zeitreisegeschichte und damit verbunden dem Ausbilden von Parallelwelten neue Schübe gibt. Ganz bewusst hat Stableford seine Geschichte nicht nur im Jahre 1822, sondern vor allem in Yorkshire als Herz der industriellen Revolution angelegt. Wenn in der zweiten Hälfte der Geschichte aus der Zukunft von einer mit Dampf betriebenen Zeitmaschine gesprochen wird, so ist diese an den Steampunk erinnernde Botschaft doppeldeutig, denn Stablefords Theorien gehen über das normale Maß hinaus und beginnen sich im Mittelteil umeinander zu winden, so dass der Plot nicht mehr selbsterklärend wird und wirkt, sondern unter dem doppelten Gewicht einer globalen Katastrophe - ausgelöst durch einen weiteren Test der Zeitmaschine - sowie den Elfenbeintürmen der einzelnen Figuren zusammen brechen droht. Es ist ein schmaler Grad, auf dem sich Stableford im Vergleich zu seinen deutlich dynamischeren Alternativwelt- Horror Geschichten bewegt. Er fordert von seinen Lesern Geduld und versucht sie gleichzeitig in diese Vergangenheit mit ihren langen Reisen und langsameren Zeitabläufen, den gesellschaftlichen Barrieren und letzt endlich auch dem Umbruch vom Agrar- zum Industriestaat hineinzuziehen, bevor erst nach einem Drittel die phantastischen, teilweise durch die gruselige Atmosphäre eher implizierten Elemente einführt und Zukunft/ Gegenwart/ Vergangenheit zu einem buchstäblichen Nebel verschmelzen lässt.
Ganz bewusst hat Stableford seinen Roman auf der äußeren, für den Leser nachvollziehbaren, aber auch der inneren, alleine durch Dialoge getragenen Ebene labyrinthisch angelegt. Das Finale spielt sogar in einem Labyrinth, die Zeitmaschine braucht anscheinend ein Labyrinth, großräumig abgesperrt, um zumindest in der vorsichtigen Praxis funktionieren zu können und das Verschmelzen der einzelnen Zeitebenen führt sogar zu Begegnungen mit Fackel tragenden Gestalten der Vergangenheit oder aus der Zukunft kommend, die aus dem Labyrinth der Zeitverstrickungen nicht mehr entkommen können. Um den Leser buchstäblich auf dieses intellektuelle, aber nicht langweilige Spiel vorzubreiten, nimmt sich der Brite erstaunlich viel Zeit und im Vergleich zum ganzen Roman auch Platz. Mit Michael Laurel ist die Identifikationsfigur des Lesers kein Wissenschaftler, nicht einmal ein Philosoph, sondern ein junger Maler, der 1822 den Auftrag erhält, das Anwesen und damit auch das Labyrinth zu malen. Beides steht auf historischen Grund. Hier sollen die tapferen Angelsachsen gute siebenhundert Jahre früher mit einem spektakulären Kampf die Wikinger in die Flucht geschlagen und das heutige Großbritannien quasi gerettet haben. Der Leser ahnt schneller als die Charaktere, das diese Ereignisse inhaltlich auch aufgeholt werden. Der Besitzer des Hauses berichtet von den schemenartigen Gestalten, die er öfter im Garten gesehen hat. Sie tragen Fackeln und eilen ziellos umher. Michael Laurel verliebt sich relativ schnell in Cecilia, die Tochter des Hauses. An der abendlichen Gesellschaft nehmen mit einem Musiker – Stableford stellt vielleicht zu wenig nachhaltig die schönen Künste der aufkommenden Wissenschaft gegenüber -, ein Hypnotiseur – auch ein Aspekt, der anders und effektiver in die Handlung hätte eingebaut werden können – und den Erfinder der Zeitmaschine gegenüber. Dieser will am nächsten Tag einen dritten und abschließenden Versuch starten.
Am Vorabend beginnen die einzelnen Protagonisten die Ideen der Zeitreise zu diskutieren. Stableford stellt ohne Frage geschickt nicht nur verschiedene, aus anderen Werken bekannte und H.G. Wells entgegenlaufende Thesen gegenüber, er verzichtet auf jegliche Positionierung und überlässt es vielleicht ein wenig zu opportun dem Leser, sich eine eigene Meinung zu bilden. Das Interessante an dieser Vorgehensweise ist allerdings, dass sich zwei Modelle herausbilden. Jede auch fehlgeschlagene Reise mit der Zeitmaschine egal ob in die Vergangenheit oder nicht durchgeführt in die Zukunft reist eine Art Loch in die Kontinuität und beginnt ein neues Universum, eine Parallelwelt zu erschaffen, die ab dieser Sekunde ein wenig anders verläuft. Ein Kitten dieser Lücken scheint es nicht zu geben. In dieser Hinsicht wird lange darüber gesprochen, ob man überhaupt das Risiko eingehen darf, den Zeitstrom zu verletzen oder ob diese potentiellen Veränderungen nicht schon der Erwartungshaltung des Universums entsprechen und eingeplant sind. Folgerichtig spinnt Stableford aber seinen Faden weiter. Es bestünde die Möglichkeit, das die Fackel tragenden Schatten/ Silhouetten die Reisenden selbst sind, die aus einer anderen Zeit kommend nicht mehr in ihrer Gegenwart gelandet, sondern in einem leicht verschobenen Universum gestrandet und quasi den Ausgang aus dem zeittechnischen Labyrinth suchen. Im Finale des Buches geht Stableford noch einmal intensiver auf diese faszinierende und herrlich verdrehte, unheimlich klingende Idee ein.
Der zweite Weg mit der Aufhebung jeglicher Veränderungen in der Vergangenheit durch die ferne Zukunft, welche hochnäsig auf die Dampf Zeitmaschine zurückschaut, wird am Ende ein wenig überbetont und folgt den Klischees des Genres. Zwar versucht der Autor diese komplette Löschung durch die obligatorische, wie wichtige Reise zum Brennpunkt der Geschichte zu relativieren und fügt seinem über weite Strecken intellektuell interessant aufgebauten Buch noch einen kleinen Action Exkurs hinzu, aber das Eingreifen aus der Zukunft erdrückt förmlich die kurz zuvor angesprochenen guten Ideen mit den Parallelidentitäten. Viele Leser könnten die zahlreichen vielleicht sogar zahllosen intellektuellen Diskussionen, die Spekulationen hinsichtlich der Auswirkungen verschiedener Zeitreisekonzepte und schließlich auch die pseudowissenschaftlichen Theorien als langweilig und langatmig empfinden. Selbst die sich wie ein roter Faden durch den Roman ziehende Warnung vor der ultimativen Katastrophe bei einer weiteren Reise wirken rückblickend aufgesetzt und werden zu stark angesichts der Konsequenzen beschworen. Auf der anderen Seite ist Brian Stableford ein so guter, routinierter Erzähler, das er mit gut geschriebenen Dialogen den Leser nicht nur bei der Stange halten kann, sondern die einzelnen Positionen vor allem sehr unterschiedlich gebildeter Menschen überzeugend und dreidimensional herausarbeiten kann. Der Autor leistet Überzeugungsarbeit und verschiebt allmählich den Fokus von Unglauben zu Angst bis zur abschließenden positiven Erlösung. Dabei platziert der Autor die Zeitreiseidee gut siebzig Jahre vor Wells wie schon angedeutet in das Herzen der industriellen Revolution. Er vergleicht einer der ersten Reisen mit einem für Passagiere zugelassenen Zug nach Yorkshire mit der kurze „Zeit“ später erfolgenden Reise durch die Zeit. Für die kleine Gruppe ist die Zugfahrt schon ein intellektueller, mit Skepsis ertragener Quantensprung, dessen revolutionäre Veränderungen die Protagonisten noch nicht einmal ahnen können. Kein Vergleich zu den späteren Erkenntnissen. Erst im letzten Viertel des Buches löst sich Stableford von seinem liebevoll, detailreich und gut recherchierten Hintergrund und konzentriert sich auf einer wenig technokratischen, sondern eher intellektuell verspielten Art und Weise auf die verschiedenen Zeitreisetheorien und deren dann auch greifbare Folgen.
Diese theoretisch intellektuelle Vorgehensweise kann nur funktionieren, wenn die einzelnen Charaktere überzeugend, dreidimensional und vor allem historisch so weit es geht authentisch beschrieben worden sind. Diesen Reifeprozess kann der Leser am ehesten an Michael ablesen, der nicht nur mit einem wichtigen Auftrag konfrontiert wird, sondern zum ersten Mal sich verliebt. Diese doppelten Ereignisse stellt Brian Stableford geschickt gegenüber und umgibt seinen jungen, noch beeinflussbaren Protagonisten eben mit den schönen Künsten, die er als Maler auch vertreten soll und den pseudowissenschaftlichen Aspekten wie Hypnose. Die harten Wissenschaften finden ausschließlich im „Off“ statt. Diese aus so unterschiedlichen Typen zusammengesetzte Zufallsgruppe funktioniert so gut, weil sie ihre Positionen nicht nur überzeugend und nachhaltig vertreten können, sondern auch widerwillig sich gegenseitig positiv befruchten und die neue Situation mit unterschiedlicher Geschwindigkeit annehmen. Insbesondere in der Mitte des Buches nimmt das Geschehen auf dieser subtilen Ebene an Fahrt auf und der Leser spürt gar nicht, wie ohne eigentliche Bewegung innerhalb der Handlung der Plot trotzdem geschickt und erstaunlich emotional ansprechend ausgearbeitet wird. Dabei bleibt offen, ob Brian Stableford sich absichtlich an den Romanzen des 19. Jahrhunderts orientiert hat oder einfach mit seiner so ungewöhnlichen, aber lesenswerten, leider nicht alle spektakulären Ideen nachhaltig und befriedigend extrapolierenden Geschichte einen anderen für den Leser anfänglich allerdings auch gewöhnungsbedürftigen Weg gehen wollte.
- Format: Kindle Edition
- Dateigröße: 1839 KB
- Seitenzahl der Print-Ausgabe: 226 Seiten
- Verlag: Wildside Press (21. März 2013)
- Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.
- Sprache: Englisch
- ASIN: B00BYJA1NM
