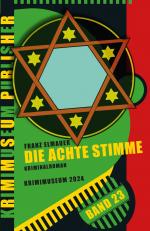Als Band 23 seiner „Krimimuseum“ – Publikationen präsentiert Mirko Schädel mit „Die achte Stimme“ einen Krimi, der bei seinem Erscheinen 1930 im Wiener Saturn Verlag genauso brandaktuell und hoffentlich nicht prophetisch ist wie in der Gegenwart.
In seinem kurzen Nachwort konnte der Herausgeber zwar keine bibliographischen Angaben über den Autoren Franz Elmauer machen, nur aus dem Verbot fünf Jahre nach der Erstveröffentlichung durch die Reichschriftenkammer, dem Innenministerium untergeordnet. Nach der Lektüre kann der Leser ein solches Verbot durch die Nationalsozialisten nachvollziehen, denn insbesondere in der ersten Hälfte des Buches präsentiert Franz Elmauer in seiner in Österreich angesiedelten, aber auch im Deutschen Reich gerne genutzten Methode der Agitation, Infiltration und vor dem Oberspülen von geistig minderbemittelten und deswegen neidisch auf den hart arbeiteten Erfolge anderer Menschen schauenden rechtsradikalen Welle, denen es nicht um Recht und Gesetz, sondern opportunistisch um die eigenen Vorteile geht.
Dabei spielt der Mord an einer jungen, im dritten Monat schwangeren Frau erst in der zweiten Hälfte der Geschichte eine wirklich tragende und tragische Rolle. Dr. Franz Bruckner wird zum Bezirksgerichtsadjunkt in dem kleinen Ort Nussberg ernannt. An der Seite des Protagonisten – er verschwindet phasenweise aufgrund „persönlicher“ Probleme im weiteren Teil der Geschichte aus der Handlung – lernt der Leser diesen kleinen, oberflächlich beschaulichen Ort kennen. Markant ist auf der einen Seite die von zwei Juden betriebene Fabrik. Modern mit für die Zeit guten Arbeitsbedingungen und vor allem erfolgreich. Auf der anderen Seite eine nahe an der Paranoia lebende alte Gräfin, die sich als verlängerter Arm des schon lange nicht mehr lebenden Kaisers sieht und ihre Angestellten drangsaliert; der Meinung ist, dass ihre Wille auf ihrem Grund unabhängig von Gesetzen durchgesetzt werden muss und wie eine stetig wachsende Anzahl an Menschen den Juden im Ort kritisch gegenübersteht.
Gleich mit seinem ersten Fall gerät Bruckner zwischen die Fronten und muss lernen, dass eine ihm angebotene Geste der Höflichkeit gleich als Bestechung, als Freundschaft mit den Juden angesehen werden kann. Da zusätzlich die Wahlen vor der Tür stehen, reist immer wieder zu wichtigen Terminen braunes Gesindel aus der Stadt inklusiv des zurückkehrenden Sohns eines örtlichen Gastwirts an, um bei den Prozesse oder politischen Versammlungen Unruhe zu stiften und gegen die örtlichen unbescholtenen Juden zu giften.
Der zweite Fall ist der Mord an einem jungen Mädchen, das im dritten Monat schwanger ist. Dieser zweite Aspekt fällt im Laufe der Ermittlungen entweder unabsichtlich durch den Autoren oder absichtlich wegen der polemischen Vorgehensweise der Behörden unter den Tisch.
Aufgrund der Denunziation zweier undankbarer Einwohner des Dorfes wird ein jüdischer Kaufmann erst beschuldigt und dann verhaftet. Viele halten ihn für unschuldig. Seine Angaben sind schlüssig, ergeben aber kein Alibi.
An einer Stelle diskutiert der Autor die Frage, ob ein die Wahrheit sprechender Jude nicht automatisch ein Lügner ist, weil er die Wahrheit spricht? Es ist eine der philosophischen Passagen des Romans, die sich mit grundlegenden Problemen auseinandersetzen. Der Mord wird zu einem Ritualmord stilisiert, für den es in der jüdischen Geschichte keine Beweise gibt.
Aufgrund einer Indizienkette und den passend ausgewählten Geschworenen nimmt das Schicksal seinen Lauf. Der beschuldigte Jude Fromm - auch diese Namenswahl ist kein Zufall - versteht - wie einige Mitbürger - die Welt nicht mehr. Es geht auch mehr um die Profilierung gegenüber den eigenen Vorgesetzten als ein vernünftige Aufklärung. Die politischen Ränkespiele sind deutlich interessanter als die “kriminellen” Elemente dieses ersten Teils der Geschichte.Sie endet mit der Abrufung Bruckners. Bruckner ist einer der wenigen standhaften Charaktere dieses Romans, der nicht nach parteipolitischen Opportunitäten handelt, sondern den Menschen sieht. Frank Elmauer präsentiert am Ende der Geschichte einen weiteren, deutlich weniger aufrechten Mann, der im richtigen Moment einen Blick auf die richtige Stelle wirft und damit den Fall “löst”. Natürlich hätte er auch das Beweisstück verschwinden lassen können. Bei seinen übernommenen Ermittlungen hat er zwar ganz kleine Fortschritte erzielt, aber richtig zügig ist er bis zur Überführung durch ein Missverständnis und gegen den Wunsch seiner Vorgesetzten nicht weitergekommen.
Mit der Verurteilung nimmt die Geschichte eine interessante Wende. Franz Elmauer beginnt sich mit der schwierigen Frage auseinanderzusetzen, wie lange das Beichtgeheimnis Bestand haben muss, wenn es um Unschuldige geht und der Schuldige nicht einsichtig ist. Der Leser kennt den eigentlichen Täter. Es kommen auch nicht viele Charaktere in diesem Buch in Frage. Ein Mönch wird vor eine sehr schwierige Aufgabe gestellt. Normalerweise hätte dieser Handlungsstrang mit entweder eine falschen Geständnis und den daraus abgeleiteten Folgen oder dem Eingreifen des örtlichen Kirchenvorstands enden müssen. Franz Elmauer versucht, die beiden Positionen - Kirche und Gesetz - gut gegenüberzustellen. Dabei geht es auch nicht mehr um die Frage, ob es sich bei dem Beschuldigten um einen Juden handelt oder einen Christen. Es ist die Schwere des Verbrechens, für das ohne Einsicht des Täters keine Absolution erteilt werden kann. Es ist auch die Frage, ob man beide Augen zudrückt und auf Gerechtigkeit nach dem Tode des Täters hofft, wobei man angesichts der drohenden Todesstrafe für den unschuldig Verurteilten ein Leben auf das eigene Gewissen lädt. Am Ende löste sich dieser spannende und intellektuell sehr gut von weltlichen und kirchlichen Vertretern diskutierte Handlungsstrang leider hinsichtlich des ganzen Falls in Luft auf. Auswirkungen hat der Exkurs aber trotzdem auf das Gewissen und die Psyche des eigentlichen Täters.
Es ist fast überraschend, aber nicht unbedingt positiv, wenn am Ende der Gerechtigkeit mit viel zu großer Verzögerung Genüge getan wird und trotzdem nur gebrochene Menschen zurückbleiben, sind es die von Mirko Schädel auch angesprochenen prophetischen Zwischentöne, welche “Die achte Stimme” - der Titel bezieht sich auf das Urteil des Geschworenengerichts - zu einem zeitlosen Werk machen. 1930 drei Jahre vor der Machtergreifung in Deutschland und gute acht Jahre vor dem Anschluss Österreichs an das Reich veröffentlicht hat Franz Elmauer ein gutes Gespür für die politischen Unterströmungen, welche die phlegmatische Weimarer Republik mit ihrer Inflation und ihrer Unregierbarkeit wegspülen sollten. Es sind politische Brandstifter, welche sich mit ihrem proletarischen Verhalten auch in den kleinen Dörfern breit machen und die nicht nur politische, sondern auch vor allem soziale Balance anfänglich unterminieren und mit ihren Parolen schließlich vernichten. Zurück bleibt das Misstrauen gegenüber Menschen, die einem seit Jahren bekannt sind und auf der anderen Seite die Angst vor dem Nachbarn und dessen Hass gegen die Juden. Dabei sind die Juden wieder der obligatorische Sündenbock, deren Erfolg - in diesem Fall basierend auf harter Arbeit und Fleiß im Gegensatz zur Faulheit und Trunksucht der Christen - von den Menschen geneidet wird, die sich selbst in ihrem Leben am meisten im Weg gestanden sind. Für diese Kleingeister stellt die Partei - sie wird namentlich nicht genannt, ist aber klar zu erkennen - ein Ausweg dar, der sie von den untersten sozialen Stufen hinsichtlich ihrer Machtbefugnisse nach oben spült. Sie fühlen sich erhaben und beginnen mit ein er Tyrannei des Schreckens. Wehret den Anfängen könnte über vielen Kapiteln stehen.
“Die achte Stimme” endet fast zu abrupt, allerdings auch stimmig. Das Missverständnis ist durch die Art der Übermittlung schlüssig und der in den Brennpunkt geratene Täter muss davon ausgehen, dass man ihn abholen wird. Auch seine Reaktion ist für den Leser nachvollziehbar. Es ist ein kleiner Zufall, der schließlich den Fall abschließt. Franz Elmauer wickelt den Roman auf vielleicht zwei oder drei Seiten schließlich ab, nachdem die Exposition mit Bruckner Ankunft in dem kleinen österreichischen Dorf, die Verhaftung und Verhandlung des Juden Fromm; die Wallfahrt inklusive Beichte und der Diskussion des moralischen Dilemmas und schließlich die eher als Hobby aufgenommene weiterführende Ermittlungsarbeit den breitesten Raum in diesem spannenden, politisch leider inzwischen wieder zeitlosen Krimi eingenommen haben. Das ist aber nur ein kleiner Wermutstropfen bei einem dank des Nachdrucks wieder zur Verfügung stehenden Kleinods des politischen Krimis.