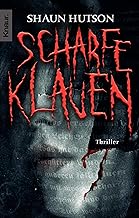Der 2006 veröffentlichte übernatürliche Thriller „Dying Words“ zeigt Shaun Hutsons Stärken und leider auch Schwächen deutlich. Auf der einen Seite besticht der Roman durch zwei rasante Sequenzen zu Beginn und am Ende der Geschichte, wobei insbesondere ein Teil des Finals aus Tobe Hoppers „The Funhouse“ stammen könnte. Zwischen diesen beiden cineastischen, aber nicht grundlegend logischen Extremen liegen einige sehr gute geschriebene Passagen mit überzeugenden, ein wenig extrem angelegten Charakteren und Einschüben, welche auf die Identität des Täters gegen alle logischen Wahrscheinlichkeiten und alle gegenteiligen Hinweise hindeuten.
Detektiv Inspektor David Birch geht in seinem Job auf. Er arbeitetet für die Mordkommission. Der Job hat ihn seine zweite Ehe gekostet, seine erste Frau ist früh an Krebs verstorben. Birch übernimmt die härtesten Fälle und hat zusammen mit seinem Kollegen viele grauenvolle Morde gesehen. Jetzt jagt er einen Kinderschänder und Mörder durch London. Anfänglich jagen sie ihn mit ihrem Wagen, wobei der Verdächtige wenig Rücksicht auf Unschuldige nimmt. Später zu Fuß. Dabei verletzt er mindestens einen Kollegen schwer. In der U- Bahn nimmt er auf dem Bahnsteig eine Geisel und will freies Geleit. Birch lässt ihn lieber zusammen mit der Geisel töten, als das er ihn noch einmal entkommen lässt. Am Ende findet sich eine pragmatische „Lösung“, als der Mörder Birch auf die Schwächen der Justiz hinweist. Da es keine Zeugen gibt, kommt Birch mit einem kleinen Verweis seines Vorgesetzten davon.
Auf der zweiten Handlungsebene lernt der Leser die attraktive Megan Hunter kennen. Sie ist inzwischen eine erfolgreiche Sachbuchautorin und hat eine neue Biographie geschrieben. Im Mittelpunkt steht der heute unbekannte Renaissance Philosoph Giacomo Cassano, der entscheidend Dantes göttliche Komödie auf eine ungewöhnliche Art und Weise beeinflusst hat. Am Gespräch nimmt ihr Lektor Frank teil.
Kurze Zeit Später wird Frank in seinem abgeschlossenen Zimmer auf eine brutale Art und Weise ermordet. Es gibt keine Zeugen, keine echten Spuren. Niemand hat einen Täter das Haus betreten oder verlassen sehen, obwohl er voller Blut gewesen sein müsste. Shaun Hutson inszeniert ein klassisches Locked Room Mystery. Im Zimmer findet sich neben einem Exemplar von Megan Hunters neuer Biographie auch ein zerfleddertes Buch des Horrorautors Paxton. Kaum beginnt sich Birch in den Fall einzuarbeiten, wird er zu einem zweiten Mord gerufen. Ein eher provokanter Kritiker ist ebenfalls in seiner Wohnung ermordet worden. Auf eine vergleichbar bestialische Art und Weise. Wieder finden sich die beiden Bücher – die Seiten herausgerissen und verstreut – am Tatort.
Birch nimmt sowohl mit dem aus seiner Sicht arroganten Paxton wie auch der attraktiven Megan Hunter Kontakt auf.
Shaun Hutson baut – bis auf eine dritte, eingeschobene und zu schnell auf den einzigen in einem Horrorroman in Frage kommenden Täter hinweisende dritte Handlungsebene – geschickt mit einer Handvoll unlösbarer Morde Spannung auf.
Bis auf die angesprochenen brutalen Szenen ist “Dying Words” über Zwei Drittel der Länge ein klassischer Detektivroman. Dabei beschreibt Shaun Hutson “nur” die Verstümmelungen der Opfer. In seinen früheren Romanen hätte er diese Szenen bis an die Grenze der Verträglichkeit sadistisch- voyeuristisch durchgespielt. Die Verbindungen zwischen den einzelnen Opfern - natürlich werden noch mehr Menschen getötet -, die fehlenden Spuren an den Tatorten hinsichtlich des Eindringens und schließlich auch die Lügen der in der Theorie nicht verdächtigen dem literarischen Zirkel angehörenden Personen sind das Fundament des spannend Mittelabschnitts des Romans. Der “Täter” ist Birch in einigen Punkten deutlich voraus, wobei sich erst im Nachhinein herausstellt, dass Birch selbst unabsichtlich die Hinweise liefert.
Shaun Hutson nimmt sich für den Krimi Part sehr viel Zeit. Birch untersucht die Tatorte, hofft auf Hinweise. Er verhört eine Reihe von unterschiedlichen Charakteren. Folgt jeder kleinen Spur und erhält im Grunde nur Informationen, die oberflächliche Verbindungen zwischen den Opfern aufzeigen, aber keinen Hinweis auf den Täter anbieten. Hinzu kommt das mehrfach verwandte “Closed Room” Mystery, eine besondere Meisterklasse im Bereich des Kriminalromans. Seit vielen Jahrzehnten haben sich unterschiedliche Autoren an dieser Ausgangsidee versucht. Hinsichtlich der Auflösung zeigt sich bei “Dying Words”, dass es sich bei dieser Geschichte um keinen durchgehenden Krimi handelt und Shaun Hutson den Plot schließlich von der Realität in den angesprochenen Bereich der Metafiktion heben muss. Ohne das der Brite streng genommen hier eine neue oder grundlegende originelle Idee anbietet. Aber die einzelnen Versatzstücke passen sehr gut zusammen.
Megan Hunter ist Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Die Wendung erfolgt, als Megan Hunter Giacomo Cassanos Theorie hinsichtlich der Verbindung zwischen Künstler/ Kunst/ Opferbereitschaft erläutert und vor allem der Geschichte die Idee der Metafiktion hinzufügt. Birch ist der ungläubige Thomas. Er ist ein Mann, der mit beiden Beinen in der Realität steht und der(aus seiner Sicht) ein gewichtiger Block zwischen Verbrechern/ Verbrechen und der Gerechtigkeit bzw. dem Schutz von Unschuldigen bis an die Grenze des Vigilanten steht.
Birch kann noch akzeptieren, dass ein Künstler persönliche Opfer bringen muss, um seine Fähigkeiten in schriftstellerischer oder graphischer oder künstlerischer Richtung zur Geltung zu bringen. Van Gogh wäre ein klassisches Beispiel. Aber auch die Kunstfigur Giacomo Cassano, der für seinen Glauben durch die kirchliche Hölle gehen musste. Auch Megan Hunter ist von diesem Fluch betroffen. Diese Offenbarung gehört zu den besten, zu den am meisten emotionalen Passagen des Buches. Sie funktionieren nur, weil Shaun Hutson mit Megan Hunter eine interessante weibliche Figur entwickelt hat, welcher der ein wenig gehemmte, in seinem Beruf aufgehende und durch den Tod seiner Frau immer noch emotional blockierte Birch gegenübersteht.
Megan Hunter liefert zwei Beweise ihrer Theorie. In einer verschwindet die Grenze zwischen realer Vergangenheit und manipulierter Gegenwart. Verstörend ist, dass ein Druck auf die Delete Taste alles verändert. Der chronologisch erste Beweis ist eine der erotischen Szenen, die Shaun Hutson seit Anbeginn seiner Karriere genau wie seine Splatterpunk-Exzesse überzeugend schreiben kann.
Mit diesen Beweisen rutscht die Geschichte aber auch mehr und mehr in den Bereich des Horrors. Interessant ist, dass Birch diesen finalen Schritt nicht ohne Megan Hunters anfängliche Hinweise und später aktive Hilfe vollziehen kann. Das ist auf der einen Seite die Stärke dieses Buches, das Verteilen auf verschiedene Schulter, aber auf der anderen schwächeren Seite der finale Hinweis, der sich aufgrund fehlender Alternativen in den zwischengeschobenen, kursiv gedruckten Abschnitten auch angedeutet hat.
Ablenkung verspricht nur noch der überaus erfolgreiche, ein wenig nach Stephen King gezeichnete Horrorautor Paxton, dessen jeweils neuer Roman eine literarisch- kommerzielle Sensation ist. Inhaltlich scheint Paxton allerdings mehr mit Shaun Hutson, James Herbert oder Peter James verwandt zu sein. Shaun Hutson verspottet ein wenig den Hype um die minderwertigen, aber auch verführerisch lesenswerten erfolgreichen Horrorgeschichten. Menschlich ist Paxton ein egoistischer Narzisst, der Frauen während der kurzen Affären ein schönes Leben schenkt und dafür Sex erhält. Er ist nur an einer ernsten Beziehung interessiert.
Der Horror Part wird mit einer phantastischen Idee eingeleitet. Was ist, wenn die Literatur die Realität beeinflussen kann und andersherum? Allerdings in engen Grenzen. Was Realität geworden ist, lässt sich durch das geschriebene Wort nicht mehr verändern oder aufheben. Innerhalb dieser engen Grenzen können diese beiden Formen aber miteinander verschmelzen und deren Übergänge sind fließend.
Das Finale ist die Art von bizarrem Horror, die Shaun Hutson vor allem in den neunziger Jahren in Serie geschrieben hat. Nicht umsonst wirkt Shaun Hutson wie ein britischer Klon des Amerikaners Richard Laymon, der in seinen hastig herunter geschriebenen Thrillern voyeuristische Elemente mit Gewaltexzessen verbunden, aber rasant erzählt hat. Der Vergnügungspark ist ein perfekter Hintergrund. Die Gewalt ist exzessiv, aber nicht unbedingt explizit. Das Problem ist die unbestimmte Vertrautheit mit dem finalen Szenario. Nicht nur Tobe Hoppers “The Funhouse” lässt grüßen. Da Shaun Hutson keinen “Killer” aus dem Nichts heraufbeschwört, auch wenn dieser Killer tatsächlich für seine Opfer aus einer Art Nichts kommt, bleibt nur ein einziges, spätestens mit einem Hinweis auf die Klinik erkennbares Szenario über. Ohne zu viel zu verraten, demontiert Shaun Hutson während des Finals auch eine interessant angelegte Figur. Vielleicht werden einzelne Leser nach dem guten Ansatz und der für das Horrorgenre interessanten Ausgangsprämisse in Bezug auf das wenig subtile Ende enttäuscht sein. Shaun Hutson präsentiert eine Lösung im Rahmen seines umfangreichen, aber manchmal wie bei Richard Laymon auch schnell niedergeschriebenen Werkes. Aber der Weg dahin gehört zu seinen besten Arbeiten seit einigen Jahren, bezogen auf die Erstveröffentlichung 2006.
Hinsichtlich seines Gesamtwerks ist “Dying Words” eine Art Übergang zwischen den frühen harten Horror Romanen mit einer Dritter- Person Erzählperspektive; kurzen offen endenden Kapiteln zur Tempoerhöhung und den späteren, distanziert und weniger aggressiv emotional erzählten brutalen Thrillern, in denen Shaun Hutson das Tempo manchmal auch zu Gunsten der Protagonisten und ihres jeweiligen Hintergrunds verschleppte. Aufgrund dieser Tatsache ein guter, aber nicht perfekter Einstieg in Shaun Hutsons umfangreiches Werk.
- Herausgeber : Knaur TB (1. Oktober 2008)
- Sprache : Deutsch
- Taschenbuch : 416 Seiten
- ISBN-10 : 3426638347
- ISBN-13 : 978-3426638347
- Originaltitel : Dying Words