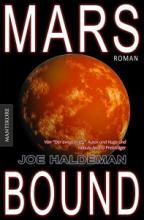
Joe Haldeman scheint sich mit dem ersten Band seiner Trilogie „Marsbound“ John Varley oder David Gerrold angeschlossen zu haben, die Jugendbücher in der Tradition Robert A. Heinleins verfassten, um sich neue Märkte zu erschließen. Interessant ist, dass er am Ende der Trilogie mit „Starbound“ und „Earthbound“ diese Idee des Jugendbuches aus der Perspektive einer heranwachsenden aber überdurchschnittlich begabten Heldin wieder verworfen hat. Neben dem Thema Generationenraumschiff im zweiten Band und der Idee einer Invasion der Erde wird mit „Marsbound“ der erste „echte“ Schritt ins All beschrieben. Alle drei Ideen sind abschließend in den ausgesprochen kompakten Romanen nicht nur miteinander verbunden worden, dem Autor gelingt es, die ausgetretenen Ideenpfade frischer erscheinen zu lassen als es der Leser erwarten durfte.
In zwei Punkten unterscheidet sich Haldeman allerdings deutlich von seinem Vorbild Robert A. Heinlein. Während der Grand Master in seinem Spätwerk nicht unbedingt expliziert, aber jederzeit greifbar die Idee der Sexualität aufgegriffen hat, darf sich die achtzehnjährige Carmen Dula schon früher bei den Jungs orientieren. Hinzu kommt, dass Haldeman wie Arthur C. Clarke wert darauf legt, das die wissenschaftlichen Faktor nicht nur korrekt sind, sondern dem Leser in einer teilweise allerdings auch ein wenig belehrend erscheinenden Art und Weise erläutert werden. Da Haldeman ansonsten einen ausgesprochen kompakten und nicht ausufernden, von unnötigen Dialogen nicht unbedingt getragenen Roman vorgelegt hat, sind diese Exkurse zu verschmerzen. Als Roman scheint der Plot aus drei sehr unterschiedlichen Novellen gewachsen zu sein. Das mag damit zusammenhängen, das Haldeman die einzelnen Teile im Magazin „Analog“ als abgeschlossene Novellen veröffentlicht hat. Diese Erklärung ist aber nicht abschließend zufrieden stellend, da er für die Buchveröffentlichung die Texte erstens deutlich besser hätte verbinden können, vielleicht auch müssen und zweitens viel wichtiger, den Freiraum des Romans im Vergleich zu den begrenzten Magazins als Chance hätte sehen müssen, die offensichtlichen strukturellen Schwächen seiner Geschichte zu beseitigen und „Marsbound“ homogener präsentieren können.
Den ersten Teil nimmt die Reise zum Mars ein. In der Phantasie ist der Mars immer noch gegen jede Realität eine Variation der alten John Carter vom Mars Geschichten. Haldeman ist zu sehr ein Traditionalist, als das er in der Gegenwart nicht auf diese überholten Wurzeln zurückgreift, welche den Ausgangsplot deutlich älter erscheinen lassen als er wahrscheinlich ist. In diesen Szenen wird der Leser am ehesten Arthur C. Clarke und seinen „Fahrstuhl zu den Sternen“ erkennen, denn Haldeman hat die Ideen des britischen Autoren mit dem Sternenfahrstuhl auf den Galapagos Inseln als Ausgangspunkt der Erforschung des Alls genauso minutiös erläutert wie die Schwierigkeiten der Raumfahrt. Alleine die technischen Aspekte sind beeindruckend und mit der subjektiven, nicht nur ausgebildeten Perspektive der heranwachsenden Protagonisten hat der Amerikaner sogar den Vorteil, das der Leser das Geschehen wirklich auf Augenhöhe verfolgt, bevor er im Verlaufe der folgenden Romane die Perspektive mehr und mehr relativiert und teilweise den Leser zu sehr vom eigentlichen Plot entfernt, um zu viele Fakten insbesondere während des abrupten Endes von „Earthbound“ zusammenzufassen und eher bemüht einen Bogen zum Auftaktroman zu schlagen. Auch wenn Haldeman der Erforschung des Alls positiv gegenüber steht, sieht er die Mühen und die Risiken. Im Vergleich zu den niemals realistischen „Träumen“ seiner dreidimensionalen, pragmatischen und nicht mundfaulen Protagonisten überzeugt dieses erste Viertel des Buches deutlich mehr als David Gerrolds eher distanzierter technischer Ansatz in seiner Jugendbuchtrilogie und ist auch meilenweit vom Raumschiff in der Garage aus John Varleys „Red Thunder“ Büchern entfernt.
Der nächste Handlungsbogen muss natürlich einen „First Contact“ beinhalten. In Büchern wie „Camouflage“ oder „The Guardian“ hat Haldeman aus Konzepte Hal Clements zurück gegriffen und wirklich fremde Wesen auf der Erde beschrieben. In „Marsbound“ hat er mit der Kolonie im Grunde sein eigenes Universum erschaffen und versucht den umgekehrten Weg zu gehen, da die fremden Menschen auf Einheimische treffen. Das auch hier die achtzehnjährige Protagonisten im Mittelpunkt steht, ist konsequent, erinnert deutsche Leser aber vielleicht zu sehr an Andreas Eschbachs Jugendbuchserie, die ebenfalls auf dem Mars spielt. Deutlich weniger technokratisch und Action orientiert streift Haldeman zwei sehr konträre Themen. Einmal die Bedrohung der Menschen durch mögliche Seuchen der Marsianer und viel interessanter, sehr viel nuancierter und ambitionierter angesprochen die Idee einer Rasse, die deutlich älter und deswegen von den Menschen so verschieden ist, die aber erstaunliche anfänglich oberflächlich erscheinende Ähnlichkeiten aufweist. Diese Suche nach Extremen, aus denen der Autor immer wieder in den einzelnen, sehr gut abgegrenzten und damit das Buch deutlich inhaltlich umfangreicher erscheinenden Kapiteln eine Balance sucht macht diese zwei „Novelle“ sehr viel lesenswerter als den ersten eher funktionalen Teil.
Der dritte und letzte Abschnitt spielt viele Jahre in der Zukunft. Der Bruch wirkt anfänglich irritierend, zumal der Leser auf seine Begleiterin, seine sich ebenfalls entwickelnde „Freundin“ verzichten muss. Hier zeigt sich zu Beginn eine deutlich stärker werdende Schwäche in Haldemans Werk. Er kann seine Bücher nicht mehr zufrieden stellend abschließen. Noch nicht so ausgeprägt wie im abschließenden Band der Trilogie wickelt der Amerikaner sein faszinierendes Szenario distanziert und vor allem nicht ganz zufrieden stellend ab. Das jeweilige Problem scheint gelöst, einige wenige Worte zum Abschied und schon wird der Leser aktiv aus der Handlung geworfen. Angesichts der Ambitionen nicht nur des vorliegenden Auftaktbandes, sondern vor allem der ganzen Trilogie eine befremdliche Vorgehensweise, die ihren negativen Höhepunkt auf den letzten Seiten seines Thrillers „Tödlicher Auftrag“ erreicht, in denen Haldeman nicht nur verzweifelt das Szenario auf den Kopf stellen möchte, sondern vor allem frustrierend das Gesehene zu relativieren sucht und damit die nicht unbedingt innovative, aber zumindest solide Grundidee ad absurdum führt. So weit ist es bei „Marsbound“ nicht, aber die Ansätze sind da. Menschen und Marsianer arbeiten inzwischen nicht nur auf dem roten Planeten, sondern in einer orbitalen gemeinsam entworfenen Station friedlich zusammen. Haldeman ist sich aber nicht sicher, in welche Richtung er den Plot wirklich entwerfen soll. Auf der einen Seite argumentiert er chronologisch „rückwärts“, in dem er mehr über die Marsianer und ihre Herkunft, ihre Besonderheiten preis gibt. Diese Szenen sind nicht nur interessant, sie harmonieren sehr gut mit der zweiten indirekten Novelle des Romans und unterstreichen die Exotik der Fremden. Auf der anderen Seite vorwärts gerichtet wird eine weitere außerirdische, deutlich paranoidere Rasse ebenfalls im Sonnensystem lebend entdeckt, welche eine Bedrohung nicht nur für die Menschen, sondern aus die Marsianer darstellen könnte. Angesichts der Tatsache, das die marsianische Zivlisation deutlich älter als die menschliche Existenz ist, sich aber mehr auf den eigenen Planeten konzentrierte wirkt diese Idee einer potentiellen Invasion eher wie eine Art „MacGuffin“, um Spannung in einem interessanten, aber sehr ruhig gestalteten Buch zu erzeugen. Die Fremden erscheinen paranoid. Auf der einen Seite wollen sie sich angeblich in den Tiefen des Alls vor den Menschen im Allgemeinen schützen. Bedenkt man, dass es erstens noch Jahrhunderte oder Jahrtausende gedauert hätte, bis die Menschheit wirklich über interstellare Antriebe verfügend in ihren Bereich eingedrungen wäre, zweitens das All unheimlich groß ist und drittens die Außerirdischen die Menschen selbst auf sich aufmerksam gemacht haben, ist ihre Vorgehensweise nicht nur dumm, sie widerspricht mit dem bislang wissenschaftlich fundierten, sehr realistischen Ansatz des ganzen Romans. Natürlich kann eine fremde Rasse gänzlich anders handeln und ihr irrationales Handeln wäre sogar ein Novum, aber die Basis muss überzeugen und in diesem Punkt scheitert Haldeman. Die Pläne der Fremden werden zu schnell zumindest vorläufig durchkreuzt. Natürlich stellt sich Haldeman geschickt gegen die stereotype und unbewiesene These, dass das Leben da draußen unbedingt intelligent sein muss, aber mit den Marsianern hat er diese Idee sehr stark unterstrichen. Auf der einen Seite können intelligente Rassen ihre Vorurteile überwinden und zusammenarbeiten, auf der anderen Seite kann er nicht nachhaltig genug und vor allem überzeugend zeigen, wie eine gänzlich andersartige Rasse überzeugend ungewöhnlich handeln kann.
Zusammenfassend ist „Marsbound“ ohne Frage ein ambitioniertes Buch bestehend den angesprochenen drei Novellen, die eher oberflächlich miteinander verbunden sind. Nach dem sehr guten Beginn und einem zumindest überzeugenden Mittelteil zerfällt die Handlung im letzten Drittel sehr stark, so dass „Marsbound“ höchstens einen ambitionierten, aber nicht zufrieden stellenden Auftakt zu einer seinem bisherigen Werk widersprechenden Trilogie darstellt.
- Broschiert: 460 Seiten
- Verlag: Mantikore-Verlag; Auflage: Deutsche Erstausgabe (18. Juni 2015)
- Sprache: Deutsch
- ISBN-10: 3945493129
- ISBN-13: 978-3945493120
