Nach „Tochter der Wüste“ hat Thomas le Blanc mit „Die Stadt der Diebe“ – der Titel der Anthologie ist bei einigen Geschichten Programm – eine zweite Anthologie mit Geschichten aus Karl Mays Orient zusammengestellt. Insgesamt fünfzehn Erzählungen – drei Texte sind eher Kurzromane – von neun Autoren ergänzen Karl Mays Original Romane.
Alexander Röder ist mit zwei langen Texten vertreten. „Die Stadt der Diebe“ eröffnet die Anthologie. Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar kehren nach Mossul zurück. In Karl Mays erstem Sechsteiler haben die beiden Helden aufgeräumt und die wichtigsten Verbrecher verhaften lassen. Inzwischen haben die Diebe wegen der schwachen politischen Führung wieder die Kontrolle übernommen. Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar werden Zeuge eines seltsamen Handels und bieten einem Juwelenhändler Hilfe an. Sie wollen einen kostbaren Familiengegenstand unmittelbar nach dem ersten Diebstahl durch die Räuberbande zurückstehlen. Der Juwelenhändler soll ihn anschließend bei sich verstecken, niemandem etwas sagen.
Mit diesem tollkühnen Plan beginnen allerdings die Probleme. Der „Gegenstand“ ist eine Überraschung, die Räuberbande hat nicht wirklich den Auftrag, etwas zu stehlen und die Ordnungshüter – bestehend aus einem Hauptmann und ansonsten unausgebildeten Feuerwehrleuten – kann die Fraktionen nicht auseinanderhalten.
Es entwickelt sich eine vergnügliche Geschichte, immer am Rande der parodierenden Farce, aber respektvoll mit dem Original umgehend. Mit dem Finale überschreitet der Autor allerdings die imaginäre Wand zwischen dem Geschichtenerzähler Kara Ben Nemsi und dem Abenteurer. Auf den ersten Blick wirkt die Pointe ein wenig zu schwach, zu pragmatisch angesichts einer unmöglichen Situation, aber sie ist zumindest konsequent und passt zu dieser hinsichtlich ihres Grundtenors unterhaltsamen Geschichte.
Alexander Röders zweite Geschichte „Die Schrecken Persiens“ reiht sich in eine Reihe inhaltlich überraschender Geschichten dieser Anthologie ein. Der Leser ist es gewohnt, Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar auf seinen Reisen zu folgen. Das ist auch in dieser Geschichte der Fall. Er ist es gewohnt, dass die Helden sich in Lebensgefahr befinden. Alexander Röder wählt hier einen spektakulären Auftakt mit einem zum Tode verurteilen Kara Ben Nemsi, der sich allerdings in Robert E. Howards „Conan“ Manier schließlich aus der gefährlichen Lage befreien kann. Auch Hadschi Halef Omar scheint sich gleichzeitig in einem anderen Teil eines gigantischen turmartigen Gebäudes in Gefahr zu befinden. Der Leser ist es weiter gewohnt, dass er fremde Kulturen kennenlernt und deren Sitten/ Gebräuche von Kara Ben Nemsi erläutert bekommt. Kara Ben Nemsi besucht mit einem Reisebegleiter die Totentürme der Parsen. Ihr Ziel ist es, einen von außen gesteuerten Konflikt zwischen den Parsen und den Muslimen zu verhindern. Auch das ist ein klassisches Karl May Thema.
Ungewohnter ist es für den Leser, dass weniger der Konflikt im Mittelpunkt der Geschichte steht, sondern Kara Ben Nemsi mit seinem Hadschi Halef Omar auf eine perfide Art und Weise klar gemacht wird, dass sie nicht willkommen sind. Eine besondere Art der aktiven Verabschiedung könnte man die Geschichte nennen. Das macht den Reiz der stringenten zweiten Geschichte Alexander Röders aus, der nicht nur mit seinen zahlreichen im magischen Orient spielenden Romanen, sondern auch seinen überdurchschnittlichen Beiträge innerhalb der ersten Anthologie „Tochter der Wüste“ bewiesen hat, dass er im Karl May Kosmos angekommen ist.
Zu den besten Geschichten dieser Sammlung gehört „Die Totenbraut“ von Nina Blazon. Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar besuchen ihren alten Freund Arminius Vambery im serbischen Beograd. Er ist in Begleitung eines jungen Engländers, der ebenfalls Schriftsteller ist. Er stellt sich als Abraham – Bram – Stoker vor und sucht Inspiration für einen weiteren Roman. Arminius bittet Kara Ben Nemsi und den kränklichen Hadschi Halef Omar an einer Reihe zu einer Hochzeits- und Beerdigungsfeier auf dem Lande teilzunehmen. Er möchte die regionalen Rituale studieren. Ein junger Mann ist vom Pferd gefallen und wurde getötet. Der Vater verhält sich allerdings seltsam. Halef wird immer kränker und nachts sehen die Freunde eine bleiche Gestalt, welche anscheinend in die Häuser eindringen möchte.
Der Reiz für Autorin und Leser ist die richtige Balance zwischen der im Grunde auf einer Variation von Romeo & Julia basierenden zeitlichen Grundgeschichte und den Anspielungen auf das, was noch kommen wird: Bram Stokers „Dracula“. Immer wieder führt die Autorin nicht nur die Protagonisten, sondern auch die Leser ein wenig an der Nase herum, erweckt in ihnen geschickt Vertrautes, spricht die vermeintliche Erinnerung an den weltberühmten Roman an, um dann im nächsten Augenblick wieder geschickt umzuschwenken. Der Titel der Geschichte ist mit sehr viel Bedacht gewählt und beinhaltet den Schlüssel für das finale Rätsel, dessen Auflösung und damit die gerechte Bestrafung der Schuldigen Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar einleiten, aber nicht beenden.
Nicht jede Mission kann grundsätzlich erfolgreich sein. “Vogelfrei” von Sabine Frambach erinnert die Leser daran. Ein junger Mann sitzt unschuldig im Gefängnis, weil er angeblich einen teuren Vogel gestohlen hat, den der britische Botschafter den Sultan zum Geschenk machen wollte. Seine Mutter bringt ihm jeden Tag Essen an das Gefängnistor. Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar beschließen, der Frau zu helfen.
Die Geschichte ist stringent. Die Gier der Diebe macht sie angreifbar. Aber wie in Nina Blazons “Die Totenbraut” erfolgt die Bestrafung nicht durch Karl Mays Helden. Das irritiert auf der einen Seite, da die Texte “unfertig” wirken könnten, aber auf der anderen Seite konzentrieren sich die beiden Autorinnen auf das Wesentliche. Die direkte und unorthodoxe Hilfe durch Kara Ben Nemsi. Auch wenn nicht jede Mission mit einem Happy End endet und Sabine Frambach die primitiven Umstände des alltäglichen Lebens und den geringen Wert eines Menschenlebens in den Mittelpunkt ihrer Story stellt.
Christian Künnes “Morgentau” könnte auch in Karl Mays Magischen Orient spielen. Auf der Jagd nach dem Schut treffen Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar auf einen verzweifelten Mann, der seine junge und hübsche Braut sucht. Am Tag der Hochzeit musste sie abreisen, weil ihre Mutter im Sterben lag. Der Autor schlägt einen weiten, ein wenig konstruierten Bogen zu einem bulgarischen Märchen. Phantasie und Karl Mays “Realität” treffen aufeinander. Der Plot ist stringent, es werden einige kleinere Klischees bedient und am Ende gibt es auch auf Augenhöhe des Lesers ein Happy End. Deutlich schwächer ist Christian Künnes zweite Geschichte: ”Die Frau in der Höhle”. Das liegt teilweise am Plot - er spielt kurz vor der finalen Auseinandersetzung mit dem Schut im sechsten Band des Orient Zyklus -, der routiniert erzählt wird. Bis auf ein oder zwei pointierte Dialoge folgt die zufällige Entdeckung eines noch schwebenden Verbrechens; die Befreiung der Frau aus den Händen eine Wahnsinnigen und das Missverständnis zum Schluss den Mechanismen des Kanon. Kara Ben Nemsi entspricht vom Charakter her eher seiner Inkarnation aus dem Magischen Orient, der seine Feinde zwar nicht mordet, aber bei deren Tod auch nicht sonderlich erschüttert ist. Aber vieles wirkt zu vertraut, als dass diese sehr kurze Story vor allem in einer mit überdurchschnittlichen Geschichten überquellenden Anthologie sich hervorheben kann.
Christian Künne ist der einzige Autor, der mit drei Geschichten vertreten ist. Bei “Im Leuchtturm” befindet sich Kara Ben Nemsi auf der Suche nach Abrahim Mamur, einem Betrüger und Dieb. In einem Leuchtturm sollen sich Schätze befinden, die er geraubt hat. Zumindest mit einer Zufallsbekanntschaft - ihm wurden wichtige Dokumente gestohlen- macht er sich nachts auf den Weg zum Leuchtturm. Um Karl Mays Chronologie nicht zu zerstören, kann diese Mission nicht wirklich erfolgreich sein. Christian Künne baut ein oder zwei originelle Ideen in die stringente Handlung ein, aber generell leidet der Plot unter einem fehlenden nachhaltigen Spannungsaufbau. Alles geht zu einfach und auch aufgrund der Kürze der Geschichte zu schnell.
Der Titel “Zwei Betrüger” ist in Kai Riedemanns kurzer Geschichte auch Programm. Kara Ben Nemsi begegnet zwei Männern, die sich als Hadschi Halef Omar und ihm selbst ausgeben. Bevor er selbst aktiv werden kann, holen die Taten die beiden Betrüger ein. Eine kurze tief in den eigenen Geschichten gesuchte Anekdote, eine Randnotiz, auch wenn Kai Riedemann seinen Ich- Erzähler ausführlich die Notwendigkeit einer vollständigen Chronologie diskutieren lässt.
“Auf dem Weg nach Maskat” (Bianca M. Riescher) geraten die beiden Freunde durch eine Naivität Hadschi Halef Omars in Lebensgefahr. Er unterschätzt die sinnflutartigen Regenfälle, welche aus Tälern reißende Ströme machen. Anschließend begegnen sie einer Handvoll arabischer Banditen, die nicht mit den Schießkünsten der Freunde gerechnet haben. Kaum wird ein Verwandtschaftsverhältnis festgestellt, ist alles vergeben und vergessen. Die Geschichte wirkt eher wie zwei Episoden einer langen Reise, was auch den Titel unterstreicht. Keine der Episoden ist wirklich originell - dazu hat vor allem Kara Ben Nemsi zu oft seine Schießkünste demonstriert, auch wenn er diese Aufgabe dieses Mal delegiert -, sie sind aber stilistisch ansprechend und detailliert niedergeschrieben worden. In ihrer zweiten Geschichte “Die Gräber von Sakkara” beschreibt die Autorin nicht nur einen Besuch bei den Pharaonen, den Pyramiden und den Grabstätten der alten Ägypter, wie so oft hören die beiden Helden in der Nacht nicht des Nachbars Schand, sondern kommen einem potentiellen Verbrechen auf die Spur. Obwohl Bianca M. Riescher den Vorgaben Karl Mays folgt und Hadschi Halef Omar nicht nur einmal, sondern zweimal der vorwitzige Tollpatsch ist, weler Kara Ben Nemsi in Lebensgefahr bringt, zeigt sie auch gleichzeitig auf, dass Held sich täuschen kann. Was im Dunkeln wie ein Verbrechen erscheint, ist den damaligen Gesetzen zur Folge noch erlaubt. Eine historisch nachweisbare Konstellation. In der Zeichnung von Hadschi Halef Omar weicht die Story von den anderen hier vertretenen Arbeiten ab. Der Plot präsentiert sich - wie schon erwähnt - als kurzweilig und unterhaltsam.
Nur selten bewältigt Kara Ben Nemsi seine Abenteuer ausschließlich im Sitzen. Thomas le Blancs “Schutzgelderpressung in Istanbul” berichtet von einer solchen Begebenheit. Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar sitzen bei einem Freund in seinem Cafe, als Schutzgelderpresser ihr Glück versuchen. Hadschi Halef Omar unterbricht deren Aktion und ist mittelbar für die Gründung einer Bürgerwehr verantwortlich. Eine kleine Anekdote, bei welcher der Leser hofft, dass die ehrbaren Handwerker und Kaufleute auch gegen die bewaffneten Verbrecher ihren Mann stehen können. Thomas le Blanc verleiht der Geschichte zumindest einen humorvollen Unterton mit einer Art Running Gag.
Während Kara Ben Nemsi im ersten von le Blanc geschriebenen Abenteuer nicht wirklich eingreifen muss, leidet er nach dem Angriff seiner Feinde und einer versuchten Entführung unter “Amnesie”. Das ist auch der Titel der zweiten Geschichte. Kara Ben Nemsi wird von einem heilkundigen Ehepaar gerettet und in ihr ausgebautes Felsen Versteck gebracht. Thomas le Blanc beschreibt dieses ausführlich, aber hinsichtlich des Handlungsverlaufs unnötig. Durch einen naiven Fehler sind die Entführer zurück und bedrohen Kara Ben Nemsi, bis die Rettung in letzter Sekunde buchstäblich aus der Tiefe kommt. Diese “Deus Ex Machina” Rettung gehört zu den bizarrsten Szenen dieser Anthologie und ist deswegen lesenswerter als einige andere Wendungen der hier gesammelten Geschichten.
Thomas le Blancs Geschichten sind unterhaltsam, dehnen und zerren an den etablierten Kanon Regeln Karl Mays und verfügen auch über pointierte Dialoge. Aber als Erzählungen erscheinen sie ein wenig zu kompakt, zu sehr fokussiert. Das Beiwerk ist vorhanden und auch exotisch farbenprächtig, aber le Blanc setzt es zu pragmatisch ein.
Schon in „Tochter der Wüste“ präsentierte Hubert Hug einen der längsten Beiträge. Auch „Das Felsendorf“ dieser Anthologie ist eher ein Kurzroman und das richtige Format für den Schriftsteller. Aus seiner in „Tochter der Wüste“ veröffentlichten Anthologie übernimmt Hubert Hug die Figur der weisen Heilerin Marah Durimeh. Ohne zu viel zu verraten, handelt es sich bei der Frau um eine von drei Figuren, die in dieser Geschichte wieder auftreten.
Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar finden in den Einöden ein verlassenes Dorf. Viele der Bewohner scheinen einer Krankheit erlegen zu sein. Die wenigen Überlebenden berichten von einer Heilerin – Marah Durimeh -, die uneigennützig nicht nur ihnen geholfen hat. Ein örtlicher Banditenführer – Mamoste – hat sie entführen lassen. Die beiden Freunde machen sich auf, sie zu befreien. Mit Erstaunen stellen sie fest, dass nicht nur ein örtlicher Schah die Bevölkerung ausplündert, sondern das der Verbrecher Mamoste ein Doppelleben führt. Er trägt die Uniform eines Generals der türkischen Armee. Aber auch in seiner Armee gibt es Kräfte, die ihm nicht wohlgesonnen sind. Im Felsendorf kommt es schließlich zum obligatorischen Showdown.
Hubert Hug hat das richtige Gespür für eine perfekte Mischung aus Tempo, Stimmungen und Dialogen. Seine Schurken sind charismatisch bis an die Grenze der Farce – solange es keinen Widerstand gibt, brutal und fordernd, ansonsten klassische Feiglinge -, der Hintergrund mit dem schwer zu erreichenden Felsendorf und seiner tragischen kurdischen Geschichte bildet einen idealen Hintergrund, welcher die Leser gleich an zahlreiche vergleichbare, aber nicht kopierte Szenen aus Karl Mays Geschichten denken lässt und die verschiedenen Herausforderungen sind überzeugend.
Wie in einigen anderen Storys dieser Anthologie ist Kara Ben Nemsi nicht der strahlende Held, der alles unter Kontrolle hat. Immer wieder muss ihm selbst aus lebensgefährlichen Situationen geholfen werden, in welche er allerdings im direkten Vergleich zu Axel Halbachs zahlreichen Kanon Geschichten eher geschlittert als leichtsinnig hinein getreten ist.
Das Finale ist ambitioniert. Zwar kann Kara Ben Nemsi ein Blutvergießen nicht gänzlich verhindern, aber unter der Führung Marah Durimehs wissen sich die Dorfbewohner auch mit den Gaben der Natur geschickt zu verteidigen. Das gibt der Novelle einen zusätzlich Reiz und hebt sich von einigen stereotypen Mechanismen des Genres deutlich ab. Hubert Hug vertraut auch deutlich mehr als seine Mitautoren dem gesprochenen Wort. Alexander Röder ist in dieser Hinsicht das genaue Gegenteil. Am liebsten würde er auf jeglichen Dialog verzichten und sich nur auf teilweise innere Monologe und ausführliche Beschreibungen konzentrieren. Das macht seine Texte herausfordernder. In Form von Kurzgeschichten oder Novellen ist diese Vorgehensweise noch leichter zu akzeptieren als bei seinen Romanen für den magischen Orient, in denen sich ein Leser manchmal förmlich eine längere Dialogeseite als Ausgleich zu dem wirklich dicht geschriebenen Text wünscht.
In der ersten von zwei Geschichten präsentiert Friedhelm Schneidewind eine Hommage an Arthur Conan Doyle und Sherlock Holmes. Kara Ben Nemsi übernimmt die Rolle. Es ist nicht die einzige Geschichte dieser Anthologie, in welcher mit den Vampirmythen gespielt wird. Aber im direkten Vergleich zu “Die Totenbraut“ ist Schneidewinds „Rätsel in Damaskus“ sachlicher, weniger emotional und fokussiert. Ein Freund bittet Kara Ben Nemsi und Sir David Lindsey, einer seltsamen Geschichte zu lauschen. Anscheinend ist seine zweite Frau eine Art Vampir, die ihrem neu geborenen Baby heimlich Blut absaugt. Auffällig sind in dem Garten des Paars die Pflanzen aus der Heimat der Ehefrau. Kara Ben Nemsi und Sir David Lindsey finden in der Bibliothek trotz einer handgreiflichen Auseinandersetzung eine überraschende Antwort auf diese Frage.
Wie Nina Blazon, Sir Arthur Conan Doyle in der entsprechenden Sherlock Holmes Geschichte und Karl May im vierten Buch des Orientzyklus spielt Friedhelm Schneidewind mit den entsprechenden Versatzstücken. Durch die Vertrautheit der Vampirlegende fügen sich im Kopf der Leser die einzelnen, geschickt verwobenen Versatzstücke gut und gleichzeitig voreilig zusammen. Kara Ben Nemsi bleibt sachlicher und die Auflösung ist überzeugend. Familiendramen gibt es bei Karl May immer wieder. Die handgreifliche Auseinandersetzung in der Bibliothek wirkt wie eine Verbeugung vor der Erwartungshaltung der Leser, die neben der intellektuellen Stimulation auch ein wenig Action benötigen.
Mit seiner zweiten Geschichte “In der Falle” beendete Friedhelm Schneidewind die Anthologie. Wie zahlreiche der kürzeren Texte handelt es sich um eine Begebenheit, die Karl May in seinen Original Romanen nicht erzählt hat. Friedhelm Schneidewind geht auf den Epilog von “Der Schut” ein und beschreibt einen Rache Versuch, den Kara Ben Nemsis Patensohn durchkreuzt. Die Geschichte ist relativ kurz, die Handlung stringent und zumindest können sich die Helden nicht auf eine unwahrscheinliche Art und Weise retten.
Wie “Tochter der Wüste” stellt auch “Die Stadt der Diebe” einen lesenswerten Begleitband zu Karl Mays Orientzyklus dar. Alle Geschichten spielen im direkten Umfeld des Sechsteilers mit den ersten Abenteuern Kara Ben Nemesis. Insbesondere die längeren Geschichten/ Novellen dieser Anthologie überzeugen, während die kürzeren Texte an einigen Stellen zu kompakt erscheinen. Aber allen an diesen beiden Projekten beteiligten Autoren ist die Freude anzumerken, Karl Mays Kosmos respektvoll zu ergänzen, aber an keiner Stelle zu reformieren. Vielleicht nur ein ganz klein wenig zu renovieren.
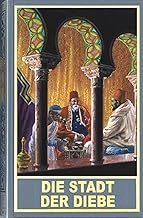
- Herausgeber : Karl-May-Verlag; 1. Edition (24. Juni 2024)
- Sprache : Deutsch
- Gebundene Ausgabe : 400 Seiten
- ISBN-10 : 3780205750
- ISBN-13 : 978-3780205759
- Abmessungen : 11 x 3.7 x 17.3 cm
